Literatur, die bewegt!
Kategorien Romane & Erzählungen Müller: Stirb nicht in der Schlacht auf Schalke
Kategorien Romane & Erzählungen Scheiber: Paul hebt ab
Kategorien Romane & Erzählungen Scheller: Endstation Marzahn
Kategorien Wissen, Natur & Technik Uhlmann: Der Schlund - im Bannkreis der Naturgewalten
Kategorien Geschichte & Geschichtswissenschaften von Keller: Wenn die Sterne Tango tanzen
Kategorien Romane & Erzählungen Marina Kramper: Seelensurfer, 230 S.
Kategorien Für die Schule Heinz Wetzel: Wo die Bäume im Wasser stehen
Müller: Stirb nicht in der Schlacht auf Schalke
Über die komplizierte Psyche eines gereiften Fußballhelden und intime Einblicke in das Millionengeschäft – teils witzig und teils spannend.
Deutschland im Jahr 2006, nach dem Ende des „Sommermärchens“: Henrik Ulrich, von allen liebevoll „Professor“ genannt, ist Fußballprofi bei einem Bundesligaverein und hat mit 29 Jahren den Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Merkwürdigerweise nutzt der Nationalspieler und Ferrari-Fahrer für die Reise aus seinem spanischen Urlaubsdomizil zurück nach Berlin ab München die Deutsche Bahn, um auf dem Weg über Ulm seine ehemaligen Vereine in Stuttgart, Frankfurt und Köln zu besuchen. Was will der Protagonist bei der Konkurrenz? Als er nachts in Berlin ankommt, liegt ihm ein gigantisches 12-Millionen-Angebot vor. Nachdem er mit Prominenten vom Fach in einer mehr als absurden Fernseh-Talkshow über die Gründe des Fußballfiebers diskutiert hat, entschließt sich Ulrich „schweren Herzens“, seinen wohl größten und letzten Vertrag zu unterschreiben – zum Entsetzen seines Trainers. Doch dann geschieht etwas für ihn völlig Unerwartetes...

Dr. Ulrich Müller, geboren 1956 in Löhne (Westfalen), studierte Musik, Germanistik und Philosophie. Er lebt seit 1982 in Berlin, wo er als Gymnasiallehrer und freier Autor arbeitet. Sein Werk umfasst Aufsätze in Fachzeitschriften sowie mehrere Bücher, u.a. Kunst und Rationalität (Philo 2001), Theodor W. Adornos Negative Dialektik (WBG 2006). Ulrich Müller ist promovierter Philosoph und Fan von Hertha BSC Berlin.
Ulrich Müller: Stirb nicht in der Schlacht auf Schalke, ca. 231 S., Broschur, € 17,95, ISBN 978-3-86992-075-7
Titelbild zum Download (300 dpi)
Leseprobe:
1.
Der Rasen der Arena sieht aus wie Holzwolle auf einer Opernbühne, aber wir Berliner merken es nicht: Ängstlich rücken unsere Abwehrreihen auf dem Pappboden zusammen, schützen das Tor mit tiefen Grätschen gegen den müden Millionensturm der Münchener, kriechen bestürzt durch das Luftkissenboot auf den Feldern von Fröttmaning, in dem uns als Rennpferde auftretende Jahrmarktponys in vorgebeugter Wildentenflughaltung heimlich auf dem Trainingsplatz einstudierte Ballstafetten aufdrängen, und stranden schließlich am späten Nachmittag in einem der aus dem Boden gestampften Fernsehstudios, wo uns in unsichtbaren Gläsern künstliche Getränke serviert werden, die auf der Zunge den faden Geschmack von Sektschorle hinterlassen, wie sie Filmschauspieler in ihren Drehpausen schlürfen. Hinter dem in der sterilen Einrichtung wie ein Papagei im Zoogehege sich gebärdenden Moderator geben mir die Scheinwerfer, die so aussehen, als hätten gewitzte Bengel einer Kindertagesstätte sie aus Plastikbausteinen zusammengesetzt, und die Torstangen, die mit der sanft fortschreitenden Nachmittagsdämmerung unmerklich verschmelzen, das Gefühl, eine dieser Spielzeugfiguren auf Weihnachtsmärkten zu sein, ein verirrter Besucher einer Welt aus Nussknackern und in Edelmarzipan gehüllten Mausekönigen, die Helden und Kaiser nachahmen, in einem als UFO gebauten Fußballstadion, das aus der Ferne einem riesigen Autoreifen ähnelt, der mal rot, mal blau leuchtet.
Ich war einmal mit Diana in Barcelona gewesen und hatte größte Mühe gehabt, aus dem Mannschaftshotel herauszukommen, derart irritiert war ich über diesen mystischen Starkult gewesen, den die Spanier bibelernst zu nehmen schienen, während sie sich in der milchigen Sonne der Stadionscheinwerfer, die ein kaltes Zahnarzt-Licht aussandten, mit den Vereinsfarben einschmierten. Von einer Religiosität, die mich abstieß, ans Zimmer gefesselt, schaffte ich es gerade noch, in ein Badehandtuch eingewickelt, das die Risswunden an Knie und Oberschenkel der Besichtigung preisgab, den Balkon zu betreten, um der frenetisch feiernden Fan-Gemeinde dort unten den Kämpfertyp vorzuführen, den sie in einem Gewimmel von Fahnen und Schals mit gepfefferten Spruchsalven als Fußballgott feierte. Nachts hielt mich der Gedanke an den Giganten Nou Camp, an das in Stierkampfatmosphäre gebettete Trommelfeuer der Barca-Anhänger unter meiner Schädeldecke, von der Liebe ab, die ich eigentlich mit Diana machen wollte, die bereits an den Weichteilen meiner Unterwelt arbeitete, während ich dieselben gerade mit Bratpfannenhänden gegen Freistoßbomben der Einheimischen zu schützen wähnte.
Jahre später landete ich mit dem Mannschaftsflieger in Madrid und verspürte genau in dem Augenblick, da wir die Flughafenhalle von Barajas betraten, den unerklärlichen, aber starken Wunsch, dich in einer Traube schwarzhaariger Madrileninnen ausmachen zu können, die verführerisch und stolz wie Venusstatuen dastanden, in deren prallen Arschbacken die unbefriedigte Geilheit hauste. Ich sah mich auf eine Bank zusteuern und den Platz zwischen dem Handyfetischismus unseres Managers, seiner Kommunikationswut, und dem Speichelsaft zweier zungen- und zahnspangenverzahnter Langzeitküsser, für die Ankommen und Abfliegen eins waren, zu besetzen und solange anzuwärmen, bis ich dich auf der anderen Seite des Gepäcklaufbandes sähe, einen Anna-Schal um das Apfelrund deiner Hüften geschwungen, das Haar zu einem Pferdeschwanz geflochten, auf mich zufliegend wie die Fee aus der Fernseh-Reklame, die ihren Namen dem Lewis-Carroll-Land entlehnt hat.
Die triste Anonymität des Hotels erzeugte in mir das erregende Gefühl sexueller Unabhängigkeit. Die roten Teppiche der kilometerlangen Schachtelflure ließen mich von Traumgirls fantasieren, die in einer Endlosschleife an mir vorbeidefilierten und ihr Armani-Night-Parfüm auf einen Wink hin in mein Zimmer trugen. Dort, wünschte ich mir, ließen sie sich bereitwillig ihre Teeny-Tank-Tops und Känguru-Cocktailkleider ausziehen, bevor ich sie in der Pfirsichwanne mit Champagner aufgeilen, schussendlich mit einer Granate von Penis in Ekstase versetzen könnte. Die Hoteldiener bedienten mich wie Angestellte eines Luxusbordells, abwechselnd mit Rehfilets und den neuesten Fußball-Nachrichten, Austern und Musikvideos. Während ich über das Teppichrot zu meinem Zimmer schritt, fühlte ich mich wie ein Diktator, dem es ebenso leicht war, mit einer Schweizerin zu vögeln wie eine Villa in der Toskana zu besitzen. Doch nachdem ich die Zimmertür hinter mir geschlossen, mein Jackett mit aufgenähtem Vereinsabzeichen über die Stuhllehne bugsiert, meinen Körper aufs Bett geworfen hatte, sah ich mich in einem Meisterschaftsspiel über den rechten Flügel vorpreschend von einem dieser Mähdrescher, wahrscheinlich einem Gelsenkirchener, oder war es ein Bochumer, scheiß drauf, von einem dieser besonders gefährlichen, gefürchteten blau-weißen Abwehrrecken durch eine Blutgrätsche zu Boden gestreckt, einen Unterschenkelhalsbruch erleidend, für ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt.
Gegen Abend bestrichst du meine Wunden mit Salbe, wie Raupen das herbstliche Blattwerk mit Speichel benetzen, ein silbriger Glibber, der in diversen Fasern stromlinienförmig über den Oberschenkel spurt, kreuz und quer gezogen bis zu den Hodensäckchen mit ihrem Haarwildwuchs. Der Holzwollrasen verfärbte sich mit der hereinbrechenden Mondnacht in ein Gespenster-Graugelb, das dem geschmacklosen Stadionbau die angsterfüllte Atmosphäre der Wolfsschluchtszene in Webers Freischütz verlieh. Eine letzte Gruppe eingefleischter Fans verließ unter Schlachtrufen, Polyesterfahnen und Billigalkohol die Tribüne, Augen und Hände zum Himmel gerichtet, innerlich aufgeräumt und mit sich im Reinen wie Gemeindemitglieder beim Erntedankfest. Die Flutlichtlampen entblößten Plastikmüllkonglomerate, welche die Leere der Zuschauerränge einem verlassenen Kriegsschauplatz anglich. Es gelang dir immer weniger, meine Blessuren zu verorten bei dem Schummerlicht, das mit Bier- und Schweißausdünstungen vermischt zum Fenster hereinströmte, uns umnebelte, dich nötigte, mich zu ertasten, als ob du nach der Nachttischlampe suchtest und sie nur deshalb nicht fandest, um deine zitternden Mikado-Glieder an die meinigen schmiegen zu können.
Ich verließ den Flughafen von Barajas auf dem Weg ins Madrilenische Zentrum, Madrid, diese Königsstadt aus Palastfenstern und Pagodenparks, in der Baedeker-Touristen mit dem Baedeker-Überdruss Bildungsbeflissener Baedeker-Urlaub vor Weltgemälden machten, die Purpurmantelkrägen glichen und sich, gefiltert durch die Strahlen der honiggelben Märzsonne, im Vereinsblau der Springbrunnen spiegelten. Ich hatte mich in diesen Zuckergussbauten noch nie gelangweilt, zumal in ihnen die Lamellen der Jalousien ein Vermeer-Licht erzeugten, das sich sowohl auf das Bettlakengrau abfärbte als auch mit dem Terrakotta der Fußbodenfließen vermischte, außerdem immer Abenteuerlust verspürt bei der Suche nach Rotweinen, die schwerer waren als die Brüste der Frauen auf spanischen Renaissancegemälden, nach Fischgerichten, die auf der Zunge den paradoxen Doppelgeschmack von fauler Frische und frischer Fäulnis hinterließen. Auf den Tag, dessen Badewannenwärme die Menschen auf die geschichtsträchtigen Plätze trieb und Espresso trinken ließ, folgte eine Nacht, deren Eskimokälte an Torwartängste bei spielentscheidenden Elfmetern erinnerte. Auf dem Frühstückstisch lagen ungelesen übereinander gelegt zwei Morgenzeitungen und warfen die Schatten ihrer fetten Schlagzeilen über gedrechselte Honigcroissants, lackierte Kaffeetassen, andalusische Erdbeeren, ohne mit der Wimper ihrer unbeirrten Ergebnissucht zu zucken, auf abgezählte Gewinne und Verluste zeigend. Ich war schon öfter in der Lautlosigkeit einer dieser stummen Stadtvillen erwacht und hatte, staunend an die Decke blickend, deren Stuckelemente sich aus dem Morgengrauen herauszuschälen begannen, nicht glauben können, jemals zwischen Engelschören und Höllengesängen Fußball gespielt zu haben, so weit war ich in diesen Augenblicken von jeglichen Sportspektakeln entfernt, Autogrammjägern, Mannschafts-einheizern, Pressesprechern.
Unmittelbar danach hatte ich die Einsamkeit aufgesucht, um den Frühlingswind einzusaugen wie das Aroma der nahen Geliebten, war in den Atem des lauen Südost getaucht, der die Haut so zart vibrieren ließ wie sonst nur Schubert-Lieder im Kammermusiksaal, berauscht vom Anblick überbordender Ginsterfluren, beruhigt wiederum durch leises Insekten-gesurre. Ich befinde mich unmittelbar vor einem Felsgestein, unter dem Wildhyazinthen hervorblühen, im zentralen Gebirge der Sierra de Gredos, zwischen Puerto del Pico und dem Tal von Bohoyo, wohin ich geflohen bin, um mich mit Höhenluft aufzutanken und hernach wieder verzehren zu können im Kampf um Bananenflanken, Präsidentenprämien und Millionenverträge. Ich bin aus der deutschen Metropole ins spanische Hochland, auf den Gutshof meines Schwagers geflohen, schaue in die Ebene und stelle mir dabei vor, ich sähe die Paläste der fußballköniglichen Stadt mit den alles überragenden Betonpfeilern des Bernabeu-Stadions im Zentrum statt an der zwölfspurigen Ausfallstraße nach Norden und könnte das ferne Meer in einem undurchschaubar geheimnisvollen Rhythmus dazu rauschen hören. Wenn ich nachts aufwache, drohen, wie immer, die fanatischen unter den fantastischen Anhängern von Anna BSC damit, beim geringsten Fehler, und einen Abspielfehler, Milan, macht doch jeder mal, ein so genannter Fehlpass ist in keinem Spiel zu vermeiden, Pfeifkonzerte gegen das Trommelfell ihrer Ballhelden zu veranstalten, unsere Nervenstränge zu strapazieren, und im selben Augenblick beginnen sie bereits, durch penetrantes Skandieren Kampfsprüche unter meiner Schädeldecke zu zementieren, immer und immer wieder einzuhämmern, bis ich sie schließlich nicht mehr loswerden kann, dazu ganze Kanonaden von Fäkalgesängen, die vor der deutschen Wiedervereinigung, zumindest in Berlin, noch an Eingeborenentänze mit Menschenopfern erinnerten, während die Stimmen der Gemarterten in Picassos Guernica der Sofia Reina entfliehen, um sich über sämtliche Straßen und Plätze der gigantischen Stadt auszubreiten.
So sah ich Pablo Vandale, den katalanischen Dribbelkünstler, der das Idol meines Vaters gewesen war, den raketenschnellen Rechtsaußen Sergio Ademayor, dem ich, aus was für abgelegenen Gründen auch immer, die Picasso’sche Friedenstaube auf seinen Glatzkopf setzte, der dadurch selbstredend viel weniger furchteinflößend wirkte, als ich ihn aus diversen Champions League-Spielen in Erinnerung hatte, der auf einmal Salvador Dali Modell saß, statt Freistöße in den Barca-Dreiangel zu zirkeln, Pablo Vandale, der erstaunlicherweise an einem Roman mit dem Titel Klub der Herzen arbeitete statt an der Verwirrung einer englischen Innenverteidigung und, wann immer er gefragt wurde, ob er keine Familie habe, antwortete: Dummkopf, der Verein ist meine Familie!
Ich sah die Verrückten unter den eigentlich fantastischen Fans von Anna, den vierfachen Familienvater, der vorm Stadiontor urplötzlich einen Totschläger aus dem Innenfutter seiner Lederjacke zaubert und mit der Selbstverständlichkeit eines Zirkusclowns in einen Regenschirm verwandelt, den im blau-weißen Wellensittichkostüm auftretenden Achtklässler, der in impulsiven Hasstiraden gegnerische Spieler als Ruhrpottkanacken, Hurensöhne, Motherficker, Pimmelkröten tituliert, die beiden volltrunkenen Krankenschwestern, welche die Warzen ihrer entblößten Brüste mit Fotos von „Zecke“ Altenstedt und Andi Schulz beklebt haben, den Schulrat aus Brandenburg, der, mit Kaschmirmantel und blau-weißer Fliege geschmückt, eher einem abgehalfterten Showmaster als einem Stadionbesucher gleicht, Annas Heimspiele regelmäßig mit Auswärts-Sauftouren in Charlottenburg und Beutezügen durch das Rotlichtmilieu am „Stutti“ (Stuttgarter Platz) verbindet, streng abwechselnd, einmal das eine vorher und das andere hinterher, das andere Mal das andere vorher und das eine hinterher, in der Mitte immer dasselbe, oder den Lehrling aus Kreuzberg, der einen selbst gebastelten Sarg mit sich herumschleppt, eingepackt in die Vereinsfarben des jeweiligen Gastvereins, zusammen mit seinen Kumpels Moritaten- und Begräbnislieder für des Gegners Leichenzug intonierend, scheinbar darum bemüht, aus dem prallvollen U-Bahn-Waggon eine durch Erschütterungen steppende Lärmgondel zu machen, die vom Stampfen und Wippen der Beerdigungsgäste im Rhythmus von D-Day-Rappern jedes Mal aus den Gleisen zu springen und an den Betonkanten des nächsten Bahnhofs, erst Kaiserdamm, dann Theodor-Heuss-Platz, dann Neu-Westend, zu zerschellen droht, gerade so, als ob die feierlich Eingesargten plötzlich den Aufstand proben und an den Totengräbern furchtbare Rache nehmen könnten, indem sie ihre Feinde durch Auswärtssiegparolen demoralisieren, niederbrüllen, bewusstlos machen, mit roten, gelben, grünen, schwarzen Vereinstüchern, Anhängerschals, Spruchtransparenten, Schwenkfahnen brutal ersticken, zusammen mit dem blau-weißen Vereinsmüll in rot-schwarze Plastiksärge legen, mit gelb-braunem U-Bahn-Müll zudecken und auf ewige Zeiten in der Unterwelt einbunkern.
Ich ging am Vereinsheim vorbei, neben dem Trainingsplatz und der Allee mit den hoch aufgeschossenen Pappeln, deren Buschkronen langsam hin und her wogten wie am Expander trainierende Unterarme, wuchtig und erhaben vor den Schafswolken des märkischen Himmels, und ich erinnerte mich an den Frührentner auf der Parkbank des Charlottenburger Schlosses, der, eingerahmt von abgewetzten Krückstöcken, ein Buch über Chiromantie las, ein intelligent aussehender Mann mit Anzug und Brille, der unbeeinflusst von der Verwunderung und dem Gespött der Menge Bücher über Chiromantie studierte, der gerade wegen des von ihm bemerkten Gelächters der Leute und inmitten ihrer Verachtung beschlossen hatte, Experte für Chiromantie zu werden, um auf seine alten Tage, denn er war in seinem bürgerlichen Beruf ein leitender Bankkaufmann gewesen, die verschiedenen Arten des menschlichen Aberglaubens besser zu verstehen und, wie er glaubte, in ihren Auswirkungen auf das alltägliche Denken und Handeln der Menschen gründlich durchleuchten zu können.
Und während ich mit meinem Sportwagen durch die nächtlichen Straßen des Bezirks Westend steuerte, im Hintergrund das hell erleuchtete Olympiastadion, dachte ich daran, wie ein schwarzhaariges Jüngelchen, die miteinander verknoteten Fußballschuhe über die rechte Schulter gehängt, sein Trikotbündel in einer Faust haltend, völlig unerwartet hinter meinem parkenden Ferrari aufgetaucht war, aus mehr als zwei Zahnlücken serbische oder, ich wusste nicht so genau, serbokroatische Brocken ausstieß, auf die ich mir keinerlei Reim machen konnte, bis ich den Bollerwagen mit dem darin sitzenden behinderten Mädchen entdeckte, offenbar die jüngere Schwester des Kleinen, die dieser mit einer Hand hinter sich her zog, so als würde ein Obdachloser seinen einzigen Besitz durch die ganze Stadt karren, da übermannte mich das Mitleid mit dem fußballverrückten Kerlchen, das seine Leidenschaft auch gegen das Familienelend behauptete. In meiner spontanen Rührung schenkte ich dem Jüngelchen die Papierlappen aus meiner Geldbörse und dachte zum ersten Mal daran, nach der Profilaufbahn die Rätselseelen der Kinder zu studieren, sie in ihren Wachträumen aufzusuchen, mit ihren unausgesprochenen Hoffnungsbildern und Versagensängsten zu leben, ihre Playmobilsprachen und ihre Hasshirnhälften zu verstehen. Lieber Kinderpsychologe werden als Gelehrter des Aberglaubens, sagte ich mir, lieber Musiktherapeut als Vereinsmanager.
Und da waren sie wieder, die groben Anna-Chaoten, Krawallmacher aus Hoyerswerda, die ihr Geschlechtsteil mit eingraviertem Vereinsemblem vor den angewiderten Ordnerfrauen auspackten, ihre Biertankfüllung in Hochbögen zwischen den gegnerischen Fans auspinkelten, daneben die zarten Anna-Chaoten, pure Nostalgiker, die Versatzstücke aus dem vergilbten Beatles-Album ihrer Jugend in Fangesänge umdichteten und dann zu unendlich vielen Strophen variierten, der Pfarrer, der die Hostien aus der eigenen Kirche entwendet hatte, um sie in der stadioneigenen Kapelle mit seinen Sportbrüdern zu teilen, in der aberwitzigen Hoffnung, die Körper der zuletzt sieglosen Elf möchten im nächsten Spiel von den Toten auferstehen, nicht zuletzt die glücklicherweise im Aussterben begriffenen Anna-Hooligans, die nachts in Rudeln herumstreunten wie hungrige Wölfe auf der Suche nach Hasenfrischfleisch, für das sie schon mal eine Dahlemer, Zehlendorfer oder Schmargendorfer Industriellenvilla ausräumten, um so ihrem instinktiven Protest gegen die Dauerarbeitslosigkeit in (Ost-)Deutschland freien Lauf zu lassen.
Nie könnte ich, dachte ich, als die noch schneebedeckten Gipfel des Puerto del Pico vor mir auftauchten und ich mich ganz allmählich darauf zu bewegte, das Heim für geistig Behinderte im Madrider Vorort Alcaron vergessen, das ich mit einer Wohltätigkeitsdelegation meines Vereins besucht hatte, Zimmer um Zimmer, in denen sich erschreckende Schreie mit beunruhigenden Schritten mischten, starre Blicke von reglos im Rollstuhl sitzenden Frauen, unkontrolliert aufeinander einschlagende Kinder, die regelmäßig unregelmäßig epileptische Anfälle bekamen, dazwischen die Pfleger, welche meist vergeblich versuchten, ihren Schützlingen zivilisierte Laute, halbwegs verständliche Sätze zu entlocken, sie auf konzentrierte Minutenarbeiten vorzubereiten, ihnen das Vollsabbern und Nasspinkeln abzugewöhnen oder, je nachdem, zu erleichtern, mit Spastikern Freiluftspaziergänge zu unternehmen, missgestalteten Jugendlichen mit Hilfe eines verstimmten Klaviers Aufmerksamkeiten, gleich welche, zu entlocken, Erwachsenen das An- und Ausziehen beizubringen wie einem Tier Kunststücke. Auch als Fußballmillionär, und Millionäre waren wir in Annas Profi(t)truppe inzwischen alle, konnte ich dieses Elend nicht einfach ignorieren, das gut geführte Behindertenheim, in dem kein Kind jemals auf eigenen Füßen würde stehen, geschweige denn einen bürgerlichen Beruf ausüben können, dachte ich in meinem knapp bemessenen Fußballsommerurlaub, den ich, durchs Zentralmassiv ziehend, nur wenige Kilometer von den Kinderkrüppeln entfernt, verbrachte.
Urlaub war für mich nicht die Auslüftung der Gedanken an Angstgegner, Tabellenstürze, Trainertiraden, nicht das Baumeln-Lassen der Seele angesichts alltäglichen Verletzungsrisikos, Stammplatzverlusts, Publikumshasses, nicht das dringend benötigte Vergessen von Kollegenkonkurrenz, Presseverleumdung, Leibesinquisition, auch nicht das zwischenzeitliche Abtauchen in Kindheitsschwerelosigkeit, Alltagsfreuden und Landschaftsneugier. Im Gegenteil, sagte ich mir, ich habe das Reisen übersatt, mehr als genug vom bloßen Überfliegen der Stadt-, Land-, Fluss-, Seen- und Gebirgslandschaften, was habe ich denn gesehen auf meinen Mammuttouren, Parforceritten durch Fußballeuropa, Fußballasien, Fußballamerika, außer Fußballstadien, Fußballspieler, Fußballfunktionäre und Fußballfanatiker, was habe ich wirklich kennen gelernt von all’ den Baedeker-Attraktionen, Prinzessinnenlandschaften, Großstadtlabyrinthen, Schlösserinseln, die ich bereist und nicht erlebt, gesichtet und nicht gesehen, benannt und nicht erkannt habe, dachte ich und musste im nächsten Augenblick bereits wieder an die verunstalteten Kinder von Alcaron mit ihren Glubschaugen, Stummelhänden, Sabbermündern und Scheißwindeln denken, Gedanken an die Madrider Peripherie und an eine außerplanmäßige Dienstreise, die mich daran hinderten, die Allgegenwart und Vielfalt der Zistrosen zu genießen, Gredos-Steinböcke zu beobachten, Pinienwälder zu durchstreifen, Steineichen wahrzunehmen, deren Früchte sowohl den iberischen Schweinen zum Fraß, als auch den Gourmets zur Herstellung des unbezahlbaren Pata Negra dienen. Nein, Urlaub war für mich der tragische Bilderspagat zwischen verblödeten Blicken kindlicher Hilflosigkeit und neronischen Verfolgungsjagden millionenschwerer Angestelltenbeine.
Ich suchte auf dem Display meines um den Hals gehenkten MP3-Players nach der Raucherstimme Gianna Nanninis und ließ sie durch die Miniaturbrauseköpfe meines Ohrhörers rieseln, um auf dem Weg durch die Sierra den mal beleidigten und wehklagenden, dann wieder aufschreienden und anklagenden Ton jener Rockgöre in meine Gedärme einzuspeisen, der mein Lebensgefühl immer wieder auf merkwürdige Weise aufbrechen und in Frage stellen konnte, der mich spüren ließ, dass in den Tiefen meiner Seele Geheimnisse lagerten, die mir bislang völlig unbekannt waren, deren Existenz ich in seltenen Augenblicken nur ahnte und die mit jedem Wort der Sängerin, Ton für Ton, an die Öffentlichkeit meines Bewusstseins befördert wurden, für die ich mir Löcher in meine Unterhose schämte, weil diese Frau mir geradeheraus und ohne Vorbehalte meine geheimsten Ängste vor Augen führte, welche ich vergeblich in die Taghelle meiner Sportbegeisterung aufzulösen suchte, die mir in entscheidenden Momenten den Blick trübte. Keyboardakkorde berührten mein Herz bittersüß wie ein starker Latte Macchiato, setzten sich in die Poren meiner Haut wie das Salz des Mittelmeers beim Sommerbaden, wenn ein Federwind die Wellen an den Plüschstrand spült:
Nace l’alba su di me
Mi lascio andare al tuo respiro
E mi accompagno con i ritmi tuoi
Ti sento in giro ma dove sei
Con tutte quelle essenze che ti dai
Non so chi sei non sudi mai sei sempre piu lontano
Volgio il tuo profumo ... .
Ich bin mit diesem rotzfrechen Seniorenbackfisch verwandt, dachte ich, warum rieche ich ihr Parfüm noch nicht in meinen Sportklamotten, warum duftet meine Stimme nicht wie ihre nach Räucherlachs und Sambuca-Feuer, warum verfolgen mich ihre Lieder nur auf Erholungsreisen und nicht in meiner Smogdomäne Berlin, wo ich bereits zum Frühstück das Forellenquintett verspeise, zusammen mit dem Kaffee die Vierte von Brahms in mich hineinschütte, zum Dessert nichts Besseres in den Regalschlitzen meiner CD-Sammlung finde als Mozartscheibchen, Mozartbildchen, Mozart-Sonätchen, immer wieder Wolfgang Amadeus, den ich in der Musikwelt über alles liebe, mal das Jeunehomme-Konzert, mal die Jagd-Sonate und hin und wieder auch die Krönungsmesse, aber eben nie Bello et impossibile, L’abbandono oder Terra straniera, Lieder, die des Urlaubs Morgenröte sind, aber keinen Fußballalltag in ein Lichterfest verwandeln können.
Wie in Berlin, bemerkte ich, während ich mir die Schnürsenkel meiner brandneuen, erst vor einer Woche im KadeWe gekauften Trekkingschuhe band, existiert auch in der Sierra kein Tag ohne Nachtleben, kein Vormittag ohne Touristenbus, keine Mittagsrast ohne den Geruch internationaler Biere um mich herum, kein Nachmittag ohne anonyme Smalltalk-Begegnungen, kein Sonnenuntergang ohne Tagträume, in denen ich grübelte und fantasierte, fantasierte und grübelte: vom Strafraumgerangel, in dem nur derjenige den Ball finden und treten kann, der ihn zuvor mit Roter Bete eingerieben hat, um seinen Ariadne-Weg durch das Spielerlabyrinth zurückverfolgen zu können; von als Schornsteinfeger getarnten Schiedsrichtern, die den Matadoren für jedes begangene Foul Ofenruß aufs Trikot schütten, bis diese, kohlrabenschwarz, nicht mehr als Mannschaftsmitglieder erkennbar sind und laut Regelbuch im anschließenden Schlachtfest, wie bei den Azteken im alten Mexiko, auf dem Altar des Fußballgottes geopfert werden müssen; von fanatischen Zuschauern, die nach jedem erlittenen Gegentor eine handfeste Prügelei beginnen, bei Fehlpässen ihrer Matadoren Küchenmesser aufs Spielfeld werfen; von Pressepromis, Spielerverkäufern, Bestechungsgeldüberbringern, von Wettspielbetrügern, die nach Zigarettensorten stinken, welche Rhinozerosexkrementen alle Ehre gemacht hätten.
In Gelsenkirchen, der Stadt von Hassel, habe ich erfahren, dass es in Berlin, außer zu WM-Zeiten, keine Fan-Meile gibt. Das Fangebiet der Hassler bezieht sich keineswegs nur auf die Enge des berühmten, Kreisel genannten Kurzpassspiels, erstreckt sich vielmehr vom südlichen Rheinland über ganz Ostwestfalen hinweg bis ins niedersächsische Heideland und sogar Schleswig-Holstein hinein, an Hassler Heimspieltagen sind die Züge bereits in Hannover, und erst recht ab Bielefeld – trotz der wieder erstarkten Borussia! – , vollgestopft mit Hassel-Freaks, denen der Hass bereits im Gesicht geschrieben steht, die keine ICE-Trasse, keine Bahnhofsvorhalle, keine Fußgängerzone mit ihren Aufputschparolen verschonen: Wer nicht singt, der ist kein Hassler, wer nicht wippt, der ist kein Hassler, wer nicht trinkt, der ist kein Hassler, wer nicht fickt, der ist kein Hassler! Das nahezu konkurrenzlose Land der Hassler ist ein Reich der Idioten und Narren, die jedes Wochenende einen blau-weißen Karnevalsumzug veranstalten, ein Gebiet krakeelender Jugendlicher, randalierender Volkstrompeter, die in die Hassel-Arena, ihren Fußballdom, pilgern, alkoholisiert und aufgeputscht in ihr ovalrundes Heiligtum wanken, um sich in Hassgesängen auf die Zerstörung des Gegners einzuschwören. In diesem Land nehmen die als Götter verehrten Ballzauberer sitzend an den Trommelritualen und archaischen Sprechmanövern ihres Fanblocks teil, von der sichtbaren Anwesenheit ihrer Fans berauscht, machen sie sich zu deren Affen wie Grundschullehrer vor ihren Kids, nur vor Rührung mit einer Gänsehaut. Es ist ein von Begeisterung vernebeltes Land, dem es an Gebirgsquellklarheit und Pumpernickel-Gesundheit mangelt, das von den Gespenstern der Champagnerseligkeit und des Austernüberschusses regiert wird. Es ist das Europa des Aberglaubens und derjenigen Schamanen, die den Weg aus dem afrikanischen Urwald in die Betonwälder der Metropolen gefunden haben. Es ist das Land der Großstadtindianer und Kleinstadtabenteurer, dachte ich, London und Gelsenkirchen zugleich vor Augen habend.
Naturgemäß nicht in diesem Hassel-, wohl aber im benachbarten Anna-Land habe ich Freunde ausgerechnet unter den verachteten Schwarzen aus Berlin-Neukölln gefunden, Musa Menanga, Baran Bolang, Chahim Rachian, deren Eltern einem Bürgerkrieg entflohen sind, sich sowohl geweigert haben, gegen, als auch für die Guerillas zu kämpfen, und die nun zum Glück nicht beim Erzfeind Hassel, sondern bei Anna, meiner, unserer Anna, um Geld und Anerkennung fighten, schnell und elegant wie Antilopen. Es sind flinke, furchtlose, selbstbewusste Jungs, von den Politikern getäuscht, von der Schule betrogen, von den Urberlinern geächtet, die, noch nicht einmal zwanzig, mit ihren Beinen auf einmal ein Vermögen verdienen und nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Erschöpft vom gemeinsamen Ausdauertraining rede ich stundenlang mit ihnen, nachmittags zwischen den Sozialwohnungen ihrer Eltern, bei denen sie nach wie vor hausen, neben den Drahtkäfigen, in denen sie mit ihren arbeitslosen Kumpels kicken, just for fun, an eine stinkende Dönerbude gelehnt, von der aus sie den ständig im Fenster liegenden Nazirentner beobachten, die mit schwangerem Bauch vorbeiwackelnde Türkin, das Dreck um sich schleudernde Mischlingskind, den schnauzbärtigen Fünfzigjährigen, der im eleganten Ausstatter-Anzug einen Mercedes besteigt, den Kampfhund, der seine Exkremente auf die Steinquader des U-Bahn-Eingangs fallen lässt, ohne dass ihn irgendein Stadtreinigungsbediensteter daran hindert.
Baran setzte sich neben mich auf eine Mauer und sagte: Anna tut alles für uns, mein Freund, und schwieg eine halbe Ewigkeit. In dieser Zeit, wusste ich, dachte er an den Platzierungskampf in der Bundesliga, auch an den neu entflammten Stammplatzkrieg in der Mannschaft, den Kampf der Alten gegen die Jungen, der Deutschsprechenden gegen die Fremdredenden, der Neulinge gegen die Veteranen, der Brasilianer gegen die Europäer, an das regelmäßig wiederkehrende Abstiegsgespenst nach Niederlagenserien, an die Luxuswohnungen, Tigerautos, Verschwendungssüchte seiner Mannschaftskameraden, an die er sich einfach nicht gewöhnen konnte.
Oft kam Carlos Maria Manuro zu uns hinzu, der einstige Mittelfeldstar seines brasilianischen Heimatvereins Palmeiras, Spielmacher der Spielmacher in Annas Fremdenlegion, der das Fußballspielen in den Favelas von Sao Paulo, zwischen den Elendshütten des Quartiers seiner zugewanderten Eltern, gelernt hatte. Er sah fast so aus wie Roberto Carlos, der legendäre Verteidiger von Real Madrid, nur viel schmächtiger und mit einem Zöpfchen im Nacken, stets in einer vornehm-aufrechten, fast etwas zurückgelehnten Körperhaltung, der seine Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit auf den ersten Blick anzusehen waren, während sein wenig athletischer, eher schmaler Oberkörper nichts von seiner außergewöhnlichen Spielkunst, Antilopenschnelligkeit und Katzenwendigkeit verriet, sein sanftes Viertelmondlächeln mehr an einen Bahnkundenberater als an einen Superstar denken ließ. Als wir wieder einmal im Weddinger Kiez herumhingen, inmitten eines Straßenparks und in der Nähe des Metallspielkäfigs, der von Weitem aussah wie ein zu hoch geratenes Affengehege im Zoo, sagte er mir in einer selbst erfundenen Mischung aus Portugiesisch und Neuköllnisch, die so originell und ideenreich war wie ein surreales Gedicht, es gebe in Berlin keine Begeisterung, er sei verblüfft darüber, dass ich als eingefleischter Berliner, Wahlberliner sozusagen, noch nicht bemerkt hätte, dass es in meiner Stadt keine echte Freude gebe. Immer nur offiziell verordnetes Jubeln, so wie auf der anderen Seite auch nur von der Vereinsleitung angeordnete oder von der Lokalpresse verhängte Depression.
Bevor er bei Anna unterschrieb, hatte die brasilianische Regierung ihm die Fußballplakette der Nation verliehen und eine Reise nach Europa geschenkt. Sie kutschierten Manuro nach Congonhas, setzten ihn in ein Flugzeug nach Frankfurt, nicht ohne ihm eingeschärft zu haben, bei welchem Herrenausstatter er sich europagemäß einkleiden solle – in seiner Heimat hatte er nur selten einen Anzug und nie eine Krawatte getragen –, mieteten ihn in einem Durchschnittshotel des scheußlichen Bahnhofsviertels ein und überließen ihn seinem Schicksal. Das schlecht oder überhaupt nicht geschulte Hotelpersonal behandelte ihn wie einen Aussätzigen, damit der trottelige Halbneger, wie sie ihn nannten, erst gar nicht an einen längeren Aufenthalt dächte, der unweigerlich das Einschleusen von Alkohol, Weibern, Drogen und anderen Seuchen zur Folge hätte, „Gell, se wisse scho, deß is e ehrwet hesisch Haus!“, und Manuro blieb verängstigt und gekränkt in seinen vier Wänden, auf der Tagesdecke seines Bettes liegend sah er an die vergammelte, fleckige Zimmerdecke, horchte auf Stimmen und Geräusche im Flur, zählte das Geld in seinem Portmonee, indem er jeden Schein einzeln zwischen seinen Fingern knistern ließ wie jemand, der auf Nummer sicher gehen will, keine Blüten angedreht bekommen zu haben. Er wollte etwas essen, aber er wagte nicht, das Hotel zu verlassen, weil es bereits zu dämmern begann und in Sao Paulo kein Fremder in der Dämmerung allein auf die Straße ging. Auf den Tag der Demütigung folgte die Nacht der Angst und nach der Nacht der Angst würde wieder der Tag der Demütigung kommen. Manuro ging eingeschüchtert ans Fenster, um sich mit der fremden Nacht bekannt zu machen, die frische Dunkelheit im honiggelben Licht der gegenüberliegenden Fenster zu erspähen, die Schatten der Straßenbäume zu erahnen, die für ihn das Zeichen waren, sich auszuziehen und seinen völlig ermüdeten, überdies vom Jetlag gebeutelten Körper unter die Betttücher zu schieben. Autolärm drang nach wie vor von der Straße zu ihm herauf, das Stimmengewirr auf den Bürgersteigen ließ nicht nach, Leuchtreklamen schickten ihr Flatterlicht durch die Ritzen der Vorhänge, ihr Rot mit deren Blau vermischend, auf dem dunklen Teppichboden violett schimmernde Streifen hinterlassend, die ihm den ersehnten Schlaf immer wieder aus den Augen stahlen. Auf einmal starrten ihn auch die Portraitierten an der Wand mit ihren Truthahnaugen grimmig an, und er fühlte sich von seinen toten Vorfahren beobachtet, die als Sänger verkleidet aus ihren Gräbern gekrochen kamen, um ihn am Einschlafen zu hindern. Manuro hat drei Tage lang gehungert, sich zwischen Bett und Schrank verbarrikadiert, seine Nase an der Fensterscheibe platt gedrückt, vergeblich versucht, den Mittag mit heruntergelassenen Jalousien auszusperren, als die Reinigungsfrau ohne jede Ankündigung das Zimmer betrat, ihn mit einem vernichtenden Blick aufscheuchte wie ein verirrtes Huhn und er sich zwischen Bett und Nachttisch stellte, wo er stumm und steif wie ein Stofftier das Ende der Säuberungsaktion abwartete.
Es war 10 Jahre später, auf der Hochebene Brasilias, nachdem er mit dem Kulturminister zu Abend gegessen, dem Fernsehen ein Interview gegeben hatte und in sein Land der Fußballbegeisterung zurückgekehrt war, in das Land der unbegrenzten Euphorie im Fußball, er, der Spielmacher der Spielmacher, dem Schreckgespenst einer Stadt entronnen, in der die Nüchternheit herrscht, mich in eine stille Nische führte, verärgert über meine Ahnungslosigkeit, Berlin betreffend, über meine Blindheit, die es mir verunmöglichte, zu sehen, dass in Deutschland, diesem reichen, bitteren Land der Denker und Dichter, die Begeisterung nicht existiert und die Leute immer mehr zu nüchternen, schalen Geldeintreibern werden, die auf der Suche nach ihrem unmöglichen Glück um die Häuser hetzen. „Du vergisst das Hassel-Land, die Arena auf Hassel und den gesamten Hassler Kreisel“, gab ich ihm zu bedenken, „wo es die bedingungslose Hingabe an den Fußball und eben diese von dir vermisste Fußballleidensfähigkeit noch gibt, wenngleich sie auch dort ganz allmählich von mäandernden Spielereinkäufern, -verkäufern, von hysterischen, geldgeilen Managern, Finanzmaulwürfen unterwandert wird, bis es irgendwann nur noch ein Fußballdeutschland ohne Unterschiede gibt, in grauem Einerlei.“
Wir standen unmittelbar neben den Leibwächtern des Ministers, am oberen Ende der Marmortreppe, deren breiter Fuß laut schmatzend von der großen Straße geküsst wurde, die direkt ins Zentrum von Brasilia führte und auf der eine kilometerlange Demonstrantengruppe der PPS vorbeimarschierte, riesige Spruchbänder mit roter Schrift hochhaltend, von Milizen umrahmt, mit Stahlstimmen Sprüche schmetterte. Die weißen Hochhäuser von Brasilia färbten sich mit dem Orange des Abends in ein mattes Gelb ein, die Luft weinte sich in Tropenfeuchtigkeit aus und ihre Trübheit war von der des Himmels nicht mehr zu unterscheiden. Gleich darauf würden die verstorbenen Fußballidole Brasiliens aus ihren Gräbern kriechen und als Schatten der PPS-Leute die Straße entlang schleichen wie hungrige Katzen, die sich in geduckter Haltung schlammigem Mäusefleisch nähern.
„Die Begeisterung in Berlin“, sagte er, „ist eine nachgemachte Freude, eine Begeisterung, die vorgetäuscht ist. In Deutschland ist übrigens fast alles nur vorgetäuscht, die Deutschen, die Flaniermeilen, die Geschäfte, die Kneipen, die Freude, die Gleichgültigkeit, der Hass. Nur die Frechheit und die Feigheit sind echt, auch die der zahllosen Hunde.“
Die Pappeln des leer gefegten Vereinsgeländes wurden von der barackenähnlichen Geschäftsstelle und den notdürftig angefügten Nebengebäuden verdeckt, in denen die schlecht bezahlten Angestellten abwechselnd mit dem Telefonhörer und der Computermaus arbeiteten. Die Neonleuchten des Vereinsheims erinnerten an die Ausstattung einer ausgedienten Bundeswehrkaserne, und auf dem Appellplatz vor den Türen würde der Oberstleutnant seine Truppen mit einer Kommandoattrappe aus irgendeinem Charly Chaplin-Stummfilm in Stellung bringen, ein letztes Mal befehligen vor dem großen Auszug, die Soldaten mit viel zu großen, im Wind wehenden Uniformen in blau-weißer Vereinsfarbe. Ein toter Annaner der Meistermannschaft des Jahres 1931 kreuzte unseren Weg, ohne uns eines Blickes zu würdigen, mit den zornigen und entzündeten Augen einer aufgebrachten Dogge.
„Ich habe Angst vor den toten Fußballstars“, bekannte ich Manuro, „Angst vor der hinterhältigen Grausamkeit ihrer Botschaft. Vielleicht nicht die toten Fußballer selber, aber die Legenden über sie, die fressen uns auf.“ Carlos Maria Manuro drehte die Pupillen seiner kastanienbraunen Himmelsaugen um 90 Grad: „Ihr Berliner seid wirklich abergläubisch“, meinte er, „nicht begeisterungsfähig, doch dafür abergläubisch. Ja, das Hassel-Syndrom, eure Fußballkrankheit!“
Erst 2003, als ich zu Anna BSC kam, um auf den Schlachtfeldern der Bundesliga zu kämpfen, bemerkte ich, dass die Begeisterung, die noch im wichtigen Aufstiegsspiel gegen Kaiserslautern allgegenwärtig gewesen war, zusehends aus dem Verein, aus der Stadt, aus den Kneipen, Straßen und Wohnungen verschwand, sich in die Randspalten der Boulevardzeitungen und in die hintersten Winkel der Menschengehirne zurückzog, sich in den Grabsteinplatten der Friedhöfe, in den Sandkisten der Kinderspielplätze, in den Tannenspitzen des Grunewalds und in den Narben der vereinseigenen Übungsbälle verkroch, bis die Spieler zuversichtlich aus dem Trainingslager in Österreich zurückkehrten, ihre wochenlang verwaiste Stadionposition wieder besetzten, der Techniker das Flutlicht einschaltete und die neu entfachte Punktspieleuphorie mit ihrer unwiderstehlichen Zweikampf- und Augenblicksspannung alle süchtig machte, die stählernen Fesseln ihrer Problemvergessenheit um Gehirnwindungen und Geldbörsen legte. Die Begeisterung, die aus Berlin verschwand, steckte im zum Himmel gerichteten Kopf des Fußballsüchtigen, der seine Familie mit erotischer Wettspielgier in den Ruin getrieben hatte, hauste im bewusstlos Besoffenen, dessen Nikotinausstöße durch meine Manteltaschen schlingerten, sie zeigte sich in den Texten der Arien, welche der Manager den Vereinsmitgliedern im Monatsrhythmus vorsang, vorausgesetzt, sie stellten den Frequenzregler auf das lokale Inforadio ein, das noch immer jede Meldung kommentarlos ausspuckt, sie lag auch auf den ungeduldigen Gesichtern der Kinder, die zwischen Trainingsplatz und Umkleidekabinen, auf Eisrasen im Winter, Autogramme von den Stammspielern erbettelten. 2003 war ich aus der italienischen Liga zurückgekehrt und hatte die schlimmen Seiten des Geschäfts zur Genüge erfahren: Fouls, Verletzungen, das Spielen unter Schmerzen, das Blöken auf der Ehrentribüne, die Verleumdungen im Zeitungsdschungel, das künstliche Hoch-gejubelt-Werden, anschließende Fallen in die Bedeutungslosigkeit, der Verlust der Trainergunst, des Selbstvertrauens, der Gesundheit, der Wunsch nach Sesshaftigkeit, schließlich auch Heimweh, aber das Schlimmste war das Sterben in der letzten Schlacht auf Hassel, ein sportliches Desaster, das ich in meiner Karriere noch nicht erlebt hatte.
2.
Ich verließ das UFO von München, die aufgeblasene, selbstherrliche Fußballwolke, auf deren Kunststoffdach die Sonne chamäleonartige Lichtspiele inszeniert, die von außen den Eindruck erwecken, als handele sich um ein fremdes, schwebendes Etwas, worin der Tag sich in Helligkeitsbündel einwickelt und zu glühen anfängt. Ich verließ das Luftkissenboot von Fröttmaning, in dem die Mehrheit meiner Mannschaftskameraden ein Testspiel von der Bedeutung eines Grashalms absolviert hatte, während ich immer noch auf Urlaubssohlen daherkam, weil ich als berufener Nationalspieler erst eine Woche später ins Training einsteigen sollte, und fuhr zu Freunden in die kleine Stadt Ulm, von der aus die im Talkessel ausgebreiteten Häuser im Schneckentempo die Schwäbische Alp besteigen, bis sie an das grüne Braun des Waldes stoßen. Junge Hausfrauen auf Fahrrädern strampelten in der Mittagshitze durch die Gassen, stolze Direktorinnen, welche die Beute ihrer Marktstreifzüge in Rucksäcken schulterten, und ich erkannte in ihren unwirschen Mienen die Fassadenrauheit des Ulmer Münsters wieder, so als hätte jemand ihre Grübchen und Fältchen mit dem Hammer von der Kalk- und Sandsteinfassade der verspielten Kirchtürme abgehauen und auf unsichtbare Weise ihren Äbtissinnengesichtern implantiert, in denen etwas von der Frömmigkeit heilig gesprochener Märtyrerinnen wohnt, etwas vom spitzen Rund des gotischen Baustils, etwas von der unergründlichen Dunkelheit des Kölner Doms, aber auch etwas von der hellen Blumenverziertheit der Kathedrale von Reims, die sich nicht dem Fehlen von Form, sondern gerade der symphonischen Formvielfalt verdankt: dem breiten Lachen der Rosetten, der Kreuzesbitterkeit von Spitzbögen, einer leptosomen Säulenschlankheit, Inbegriff ewig wuchernden Lebens. Meine Stadt, mein Berlin, meine Musik, sagte ich mir, sind die von Schinkel gebauten Museumskirchen und die nach Plänen von Knobelsdorff gestalteten Lichtkathedralen, schlichte, erhabene Gewölbe, geradezu klassische Tempelidyllen inmitten des hektischen Autoverkehrs, sinnentleerte Denkmäler mit glänzend renovierter Fassade, wie die tadellos gekleideten Hauptstädter, die weder lachen noch weinen, nur gleichgültig vor sich hinstarren, bewusstlos ihre Internetgeschäfte abwickeln, in Vollnarkose durch die Geschäfte ziehen, sich mit virtuosen Bewegungen durch das Gewimmel von parkenden Autos, Touristenströmen, Straßenverkäufern, Presslufthämmern, Restaurants, Cocktailbars, Flohmärkten, Reklameständen und U-Bahn-Eingängen hindurchlavieren, Menschen, die nicht wie wir die Last verlorener Spiele, gerissener Muskelfasern, aufbrausender Trainer, roher Beleidigungen in Boulevardzeitungen in sich tragen, zu denen das Gepfeife der Fans passt wie das Schlagzeug zur Hard Rock-Stimme.
Auf dem Weg nach Ulm erinnerte ich mich an Bayern im Winter, an den puderigen, frühlingsfrischen, fast unschuldigen Schnee Bayerns in der lichtkalten Jahreszeit, im Januar, im Februar, noch im März waren die bayerischen Alpen Sonnenkönige, geschmückt mit einem lilienweißen Purpurmantel, der den Duft von Algen und Ölen verströmte, ich erinnerte mich an die gläserne Luft, die hell war wie Santorini im Juli, rosa gefärbt vom Eisregen der Sonne, als würden Millionen Kristallschiffchen im Windschatten der riesigen Berge segeln, und ich erinnerte mich an Berchtesgaden, das sich zwischen Berggipfeln und Baumkronen in einen zartseidenen Schleiernebel gehüllt hatte, aus dem zwei schwarze Kirchtürme und ein weißer herausragten und in frommer Dreieinigkeit zu den Silberspitzen des Naturgottes Watzmann heraufschauten, an die Schipisten von Oberstdorf, die von Weitem wie Rasenmuster im Fußballstadion aussahen. Wir hatten uns ins Café gesetzt, ich hing mit Gierblicken am Lila deiner Lippen, und wir tauschten gäbelchenweise Schwarzwälderkirsch- gegen Prinzregententorte aus – Spielertausch zwischen SC Dreisam und Bavaria Stars!, schoss es mir augenblicklich durch den Kopf -, kicherten dabei wie verliebte Teenager, die soeben die Lust am Speichel des Anderen entdeckten. Ich erinnerte mich an Oberstdorf und an das Rauschen der donnernden Wasserfälle in der Breitachklamm, deren Felsen im Winter aufgeblasen waren wie die Backen der Politiker bei Wahlkampfreden und neben samtschwarzen Moosen Zierfarnen Asyl gewährten, die handgewebten Tischdeckchen alle Ehre machten. Ich dachte an Melina, die mir anvertraut hatte, dass sie sich in der sexuellen Begegnung mit einem Mann das filigrane und raffinierte Liebesspiel wünsche, dass sie sich auch beim Fußball von gleichsam körperlosen, technisch wie ästhetisch kultivierten Spielern angezogen fühle, einen Orgasmus, höre ich sie mir noch ins Ohr flüstern, erreiche ich nur auf sozusagen unmännliche Weise, männlich-ungestümes, animalisches Vorpreschen würde sie nicht im Geringsten befriedigen, einen kräftig und heftig zustoßenden Penis empfinde sie einfach nur als ekelerregend und brutal, ich dachte an jene Nacht, als ich, noch in der Umkleidekabine und berauscht vom 4:1-Heimsieg gegen den Erzrivalen Hassel, ausgerechnet Hassel, unseren Angstgegner, ihren Körper ausgebreitet vor mir sah, die sehnsüchtig entblößte Scham zwischen den weißen und weichen, säulenförmigen Schenkeln, die aus den gelben Augen rinnenden grünen Tränen, ich hörte die hellen Schreie einer von ihrer eigenen Lust erschreckten Ricke, das laute Stöhnen der runden, unbefriedigten Ricke. Ich verehre deinen breiten Birnenarsch, dachte ich, als ich im Neigungswinkel des ICE-Wagens liegend an einer Herde Kühe vorbeirauschte, die mit ihren Schwänzen wedelten wie Vereinsanhänger mit ihren Schwenkfahnen, ich stehe auf deinen geilen Arsch, die festen Wölbungen der Backen und die von ihnen eingeklemmte, sie trennende Anusfalte, die, von einem String-Tanga weinrot markiert, von meinen ungläubigen Unterwasserfingern in der Badewanne blind und blau nachgezogen wird, so lange, bis ich dein wollüstiges Durch-die-Zähne-Kichern und dieses ausgelassene Mit-den-Lippen-auf-der-Wasserober-fläche-Blubbern höre und nun meinerseits den Kopf unter Wasser stecke und anfange, am Gelb-Braun deiner Birnenhälften zu saugen und zu lutschen, die glatte Oberfläche deiner Hautgewölbe abzulecken und schließlich in das feste Fruchtfleisch zu beißen, so dass dein aufgeschreckter Mund Wasser schluckt und laut stopp ruft.
Bereits vor Melina hatte es für mich andere Frauen gegeben, meistens in den ginster-, lavendel- und margeritenfarbenen Sierraferien, inmitten von Steinböcken und Kiefern, zu denen ich von Berlin aufbrach, wann immer ich genügend spiel- und trainingsfreie Tage hatte, so dass mich jene innere Unruhe befiel, die eine Folge meines nicht ausgelasteten Körpers war, ein akuter Bewegungsmangel, wie ihn Kinder verspüren, die plötzlich in der Schule stundenlang stillsitzen und aufmerksam sein müssen, während sie zuvor beliebig miteinander spielen und herumtoben durften. An solchen Ruhetagen, die ich immer wieder erlebt, durchlitten und noch nie in den Griff bekommen hatte, konnte ich die Einsamkeit und Stille meiner Villa am Wannsee nicht ertragen, weil sie mich lähmte und zum Nichtstun verurteilte, ging ich dagegen in die Stadt, fiel mir der Autolärm auf die Nerven, den ich sonst gar nicht wahrnahm, auch die vertraute Umgebung stieß mich jetzt ab, erzeugte in mir das rätselhafte Gefühl, in der Heimat ein Fremder zu sein, einer, der nur in der heimischen Fremde der Sierra de Gredos, auf dem Gutshof seines dort so gut wie nie anwesenden Schwagers, zwischen Pinien und Gemsen, seinen Seelenfrieden finden konnte, doch merkwürdigerweise nie allein, ich benötigte dafür die aufmerksamen Augen meiner Frauen, aus denen ich die Dramatik ganzer Endspiele herauslas, ihre hündinnenwarmen Küsse auf meiner Salzhaut, deren Poren durch sie leise erzitterten, ihre Tropenfeuchtigkeit in meinen Gedärmen, die mir erst die Zufriedenheit zuteilwerden ließ, die ich sonst nur nach sportlichen Höchstleistungen verspürte.
In Ulm angekommen lief ich sofort vom Hauptbahnhof durch die röhrenförmige Fußgängerzone zum Münster, das sich mit der Erhabenheit des welthöchsten Kirchturms selbstherrlich von mir abwandte, von welcher Seite aus ich es auch betrachtete, immer schien es mir meine irdische Minderwertigkeit und moralische Nutzlosigkeit vor Augen zu führen und als Riese im breiten Priestergewand mit Nichtachtung strafen zu wollen für meine sündigen Süchte nach Geld, Ruhm, Fitness, Nervenkitzel. Ich sah das Gesicht des Münsters nicht, erahnte dessen zornigen Blick jedoch hinter jeder Häuserecke, die mich wegstieß ins Gewimmel der Passanten, deren schwere Einkaufsbeutel mich augenblicklich zu erschlagen drohten, hinter jedem Straßenbaum, der mich ansah wie ein hungriger, ausgemergelter Windhund und in mir das Gefühl der Nichtswürdigkeit erzeugte. Ich erriet den Zorn des Münsters am sich zuziehenden Himmel, am anschwellenden Lärm auf dem Münsterplatz, an meinem eigenen Schwächegefühl, der Pulsbeschleunigung, den hektischer werdenden Atemzügen und den zitternden Knien, die mich an Mauerängste bei angeschnittenen Freistößen erinnerten. Ich spürte den Münsterblick auf dem Rücken, im Nacken, an den Schläfen, sogar in meinem Bauch bemerkte ich das Auf- und Niederfahren der Münsteraugen, die für mich gleichbedeutend waren mit den Augen Gottes, die mir mit dem Dolch des Fixierens Berufsängste und Gewissensbisse einjagten, meinen erwarteten, aber ungenügenden Einsatz für die sozial Schwachen brandmarkten. Ich habe nichts gegen Gotteshäuser, sagte ich mir, im Gegenteil, ich sehne mich nach einer Kirche in der Nähe meiner Berliner Villa, die ich mir angezogen habe, um mich ausruhen zu können, mich mit blauen Büchern in rote Sesseloasen zurückzuziehen, im Greifen violetter Akkordfolgen auf meinem sonoren Bechstein alles um mich herum zu vergessen. Ich sehne mich nach einer richtigen Kirche, nicht nach einem Münster, sondern nach einem Dom, ich wünsche mir den Mailänder Dom nach Berlin, den Dom, in dessen grandiosen Gewölben ich mich verlieren kann, dessen Fassade einer musikalischen Mehrstimmigkeit gleicht, die meine Sinne verwirrt und in mir den Wunsch aufkommen lässt, seine Zuckertürmchen im Schwalbenflug zu umkurven wie ein Linksaußen die gegnerischen Abwehrspieler, mich in den Goldstatuen der lichtweißen Fassade verzerrt zu spiegeln wie ein Mannschaftskapitän in der taufrisch errungenen Meisterschale. Ich sehne mich danach, die Wohnzimmertür zu öffnen und mitten im Mailänder Dom zu stehen, an das Stuckmuster der Wohnzimmerdecke zu sehen und die Raumhöhe des Kirchenschiffes vor mir zu haben, eine Klaviermelodie zu spielen und sie in der Akustik des Dominneren zu hören, die Fenster zu öffnen, um von den Fassadenreichtümern des Doms umgeben zu sein und in der Ferne die wild übereinander liegenden Alpen zu erspähen.
Heute sehne ich mich nach der stillen Unendlichkeit der Dome, dachte ich, so wie ich mich als Kind nach der geheimnisvollen Unendlichkeit des Fußballrasens gesehnt habe, nicht nach einem bestimmten Rasen, sondern nach allen Rasenplätzen, die ich vor diesem schäbigen, stumpfen, abgetretenen Holzwollrasen kannte, kaum hatten wir Kinder das Haus verlassen, waren aus dem Schulgebäude heraus auf den Pausenhof getreten, kitzelte uns der delikate Duft deftigen Grases in der Pubertätsnase, auf den die Jugendlichen heute zumeist verzichten müssen, da sie nur noch auf diesen sterilen, pflegeleichten Kunstrasenplätzen spielen, die den Kunststoffball hellwach machen und närrisch springen lassen, die Spieler werden auf diesen keimfreien Plätzen Wiesel, die Pässe Raketen und die auf den Magnetboden tippenden Bälle Trampolinspringer. Damals liefen wir natursüchtig auf das Feld, sogen das herbe Parfüm einer feucht gemähten Wiese ein wie Softeis im Strandbad, das saftige Grün der Grashalme verbiss sich in unsere Hosen und Hemden, als hätte es die Julisonne hinein gebrannt. Da stampften sie in einem verregneten Sommer dicht neben unserem Übungsgelände eines dieser fantastischen, erbärmlichen Schulungszentren aus dem Boden, in dem über Nacht Hunderte von Kindern aus der ganzen Republik auftauchten, blutjunge Balljongleure, verbissen für einen Zukunftsprofi(t)vertrag kämpfende Teenies, kleine Verbohrte, Besessene und Neurotiker, die für das begehrte Fernziel, den Sprung in die erste Liga, trainierten wie die Tiere. Auf unseren Bällen sitzend, sahen wir Dutzende von Dribbelkünstlern, Laufwundern, kraftgeilen Muskelpaketen, schussgewaltige Schuhfetischisten, dicke Spielerberater in gestreiften Anzügen, deren Aktenordner beim Auf- und Zuklappen an Bahnschranken erinnerten, wie sie bunte Plastikhütchen in gleichmäßigem Abstand auf der Mittellinie verteilten, Fahnenstangen mit weißen Segeltüchern aufstellten, die im launischen Nordwest flatterten wie aufgescheuchte Tauben auf städtischen Marktplätzen, während von verschiedenen Seiten die rauchigen Stimmen der Vorturner ertönten, durcheinander Namen und Kurzbefehle ausstießen. Sie begannen das Training, und die Figuren der mit den dunkelblau-weißen Trikots, Hosen, Stutzen, mohnblumenroten, lilienweißen oder butterblumengelben Markenschuhen gekleideten Hüpfer glitten in Gruppen über den gesprengten Rasen, die einen fummelten Bälle um die schlangenartig zischelnden Fähnchen herum, die anderen sprinteten zwischen zwei abschlaggierigen Trainerhänden hin und her, Flankenbälle schraubten sich wie Helikopter in Torlattenhöhe, ein bierbäuchiger Herr schrie, mit beiden Armen wild gestikulierend, auf einen Strafraumspieler ein, fauchte zornig wie ein Stofftiger, der mangels Lebendigkeit echtes Aufbrausen durch nachgemachtes ersetzen musste, das in dem übertriebenen Gefuchtel und durch das abrupt entblößte Gebiss hindurch lächerlich verpuffte.
Ich sehne mich nach der Natur, dachte ich auf dem Weg durch die Ulmer Altstadtgassen, nach der Natur der Sierra de Gredos Ende Dezember, Anfang Januar, wenn sich die Gipfelflur in Schnee eingehüllt, vom Ost- über das Zentral- bis zum Westmassiv hochzeitlich verschleiert hat, wenn die verlässliche Januarsonne die Oliven tiefblau macht, den Blick auf die klare Dunkelheit der Horizonte freigibt und die blauen Umrisse Afrikas erahnen lässt, wenn die von Westen herbeieilenden Wolkenbänke den Asphalt der Straßen wie Tinte aussehen lassen, dann weiß ich, dass ich ein Zuhause jenseits des Fußballs, außerhalb der deutschen Hauptstadt, vielleicht auch inmitten des Fußballs, aber fern vom Berliner Olympiastadion habe. Ich begegnete zwei Koreanerinnen, beide im unmodern gewordenen Miniröckchen, eine Zigarette zwischen den mattschwarz lackierten Fingernägeln und mit rutendünnen, elegant gebogenen Beinen, die sie die siebenhundertachtundsechzig Stufen auf den hundertzweiundsechzig Meter hohen Turm des Ulmer Münsters hinauftragen sollten, und, bevor dies geschah, suchte ich in ihren niedlichen Puppengesichtern nach einem geeigneten Grund dafür, sie von dieser Viecherei abzuhalten, fand aber keinen, was ich auf meine mangelnde Kleinstadtkonzentration einerseits, ihre asiatische Mentalität andererseits schob. Enttäuscht ging ich in das gläserne Café gegenüber und suchte mir einen Platz an einem der Touristenfenster, die mit Argusaugen auf die Münsterfront starrten, so dass nun ich das Gefühl hatte, von allen anderen Gästen aus allen möglichen und unmöglichen Blickwinkeln angestarrt und beobachtet zu werden. Du bist ein Star, versuchte ich mich selber zu beruhigen, wenn auch nur ein Fußballstar, der im Süden Deutschlands weniger bekannt ist als im Osten und vielleicht noch im Norden. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, ja, sogar möglich, dass dich die Leute wie Kühe von der Weide ansehen, weil sie dich aus dem Fernsehen kennen oder in irgendeiner Zeitung gesehen haben. Die Farbe der Gardinen erinnerte mich an die meines Urins nach übermäßigem Genuss grünen Tees, der mich vor wichtigen Spielen wach wie ein Schäferhund und konzentriert wie Maikäfer machte. Die Stühle mit blümchengemustertem Stoffbezug waren so unbequem wie ein abgehalfterter Drahtesel, beförderten meinen leptosomen Körper an den Rand eines Bandscheibenvorfalls, als dessen Vorboten ich urplötzlich die Tatsache deutete, dass ich jeweils nach den Spielen gegen Borussia Bierstadt und SV Wesersturm, wie gesagt wird, von der Hexe gestochen worden war. Und nun kam es mir auf einmal so vor, als säßen im gesamten Café nur Krüppel, Leute mit Buckel, verwachsenen Armen, amputierten Beinen, die ihre Genesung vom Genuss ihres Cafés und ihrer Tortenstücke erwarteten, Krüppel, die sich verrenken mussten, um sich unterhalten zu können, die skurrilsten Streck- und Drehbewegungen zu unternehmen gezwungen waren, um einander zuzuprosten, Krüppel, die nicht nur nicht zu verbergen vermochten, sondern öffentlich zu demonstrieren genötigt waren, wen sie wie mit ihren hervorstechenden Glubschaugen fixierten, über wen sie wie mit schief gezogenen Mündern herzogen, was ihr verschlagener Restverstand mit falschem Zungenschlag physisch oder verbal in welchem Tonfall absonderte, ohne sich im Geringsten dafür zu schämen, weil sie sich bereits damit abgefunden hatten, nichts als lebend präparierte Leichen zu sein, die Vergangenheit anzubeten, die Zukunft zu bespucken und die Fremdheit zu hassen.
Wenn wir uns nach der Natur sehnen, überlegte ich vor dem Ulmer Rathaus im Juli, gehen wir dann durch den Metzgerturm hindurch, um die Donau zu sehen, oder gehen wir lieber in den Herrenkeller, um Gerstensaft einzusaugen? Ich war immer der Meinung, dass Restaurants Werkstätten sind, die Naturalien verarbeiten, jedenfalls die guten Lokale, welche die vor Ort gewachsenen Nährstoffe zubereiten und veredeln, um die natürliche Umgebung und Landschaft kulinarisch einzufangen und mittels Zunge und Gaumen begreifbar zu machen. Und wenn Vegetarier mit ihrem Hinweis, wir nähmen beim Essen von Fleisch das infolge der Todesangst des geschlachteten Tiers erzeugte Adrenalin in uns auf, Recht haben, warum sollten wir Fleischesser nicht genauso richtig liegen mit unserer Ansicht vom regionalen Gras- Kräuter- und Obstgeschmack eines genossenen Bratens? Ich bin mir sicher, dass jede artgerecht erzeugte und behandelte Nahrung das Aroma eines Naturstücks enthält, dass die mit Haut und Haar verzehrten griechischen Atherina das Mittelmeer in uns einschleusen, dass der fette Beelitzer Spargel den märkischen Sand in unsere Muskeln und Sehnen einlagert und dass Ziegenkäse aus der Normandie die saftigen, vom Meer verwöhnten Weiden Nordfrankreichs in unseren Zellen wachsen lässt.
Ich trat aus der Konditorei heraus und fühlte mich wie ein F-Jugend-Spieler, der sich in seinem allerersten Punktspiel ein Bein bricht: der abrupte Wechsel von der allgegenwärtigen, duftenden, aromatischen, ebenso spürbaren wie schmackhaften Natur und ihrer organischen Bewegung zur erschütternd banalen Naturzerstörung, in die ich mich jetzt versetzt fühlte, erzeugte in mir ein beängstigendes Schwindelgefühl, ähnlich dem, das mich ergriffen hatte, als ich im Trainingslager von Marbella ankam, um gegen das Sterben in Schlachten auf Hassel anzukämpfen.
Das Trainingslager in Marbella ist ein Fußballzentrum im Süden Spaniens, bestehend aus drei genormten Rasenplätzen, vier kleineren Rasenplätzen, mehreren Fußballtennisrasenplätzen und einem Fünf-Sterne-Hotel, in dem die Bundesligavereine Borussia Westend, SV Wesersturm, Bavaria Stars, VFB Weinberg und Anna BSC Berlin, aber nicht Hassel 05, ihre Rückrundenvorbereitung auf Hochtouren bringen, in dem ich mit großem Widerwillen und unter Schmerzen am Expander trainiert und dabei mein Gesicht verzerrt hatte, weil ich Leibesübungen ohne Ball hasste wie die Pest, im Fitnessraum immer tödliche Langeweile, innere Leere und Höllenqualen empfand. Unter der Sonne Andalusien in einer Folterkammer eingesperrt sein, das grenzt an Masochismus, dachte ich. Im Sommer hatte ich in Österreich Waldläufe gemacht, während es aus Kübeln goss, an Schwedischen Seen mit Schlaghänden und Stampffüßen gegen Millionen von Mücken angekämpft, die stets die Oberhand behielten, in der subtropischen Schwüle der Yucatan-Halbinsel Ausdauerübungen bis zum Erbrechen absolviert, zur Schadenfreude meines Trainer-Teams. Ich kam mit einem Papier in der Hand ins Trainingslager von Marbella, einem Verzeichnis meiner katastrophalen Laktatwerte, die für eine Vertragsverlängerung unbedingt korrigiert werden mussten, und ich schwitzte in meiner Mannschaftsuniform, die aus Jackett, Hemd, Krawatte und pechschwarzer Flanellhose bestand, wir alle schwitzten wie Affen im Bärenfell. Das Trainingslager wird mein persönliches Konzentrationslager, sagte ich mir, hier fühle ich mich wie beim Militär. Sie werden mir ein Gewehr geben, um die Eckfahnen damit abzuschießen, sie werden mir das Haar auf sechs Millimeter kürzen, um die Kopfballgenauigkeit zu optimieren, sie werden mich asketisch erziehen, damit ich mir auf Hassel die Lunge aus dem Hals laufen kann und beim Erzfeind nicht untergehe, sie werden mir einimpfen, den Ball mit preußischer Disziplin statt mit genialer Eingebung zu spielen. Und ich hatte keine Augen mehr für die Naturschönheiten Marbellas, für seine ausgezeichneten Trainingsbedingungen und den hohen Komfort des Hotels, in dessen Empfangshalle zig Verantwortungsträger durcheinander liefen, deren Gesichter immer darum bemüht waren, wichtig auszusehen, ihre Lackaffenfratze zu zeigen.
Ich hatte keine Augen mehr für die Glitzerlackfassade des Haupthauses, in der sich die Silhouetten der Vorbeigehenden flimmernd widerspiegelten, und ein breiter, kahlköpfiger Typ in gestreiftem Anzug kam angetrunken aus einem der Büros, legte fraternisierend den Arm um meine Schultern, über beide Ohren grinsend wie das Strichmännchen aus dem Kinderfernsehen: „Mich laust der Affe, wenn das nicht der Professor von der Anna ist.“ Und er erinnerte sich an mich als Jugendspieler, wie ich ihn einmal zu den Museumsvitrinen des Vereinshauses begleitete, die voller Pokale, dickbäuchiger Vasen waren, die Jubeldaten vor der Brust trugen, voller Plaketten, Ehrennadeln und Trikots ehemaliger Annaner, und dass er mit mir vor dem Foto der Meistermannschaft von 1930 gestanden, alle Meisterspieler um Hanne Sobek herum namentlich aufgezählt und in ihren charakteristischen Eigenschaften und auch Unarten plastisch wiederbelebt hatte, wofür er mir mit einer Packung meiner Lieblingskaugummis gedankt hatte.
„Wie geht es denn Ihrer Frau Mutter, junger Mann?“, fragte er mich, indem er sich einem Platzwart zuwandte, der gerade Tornetze vom Hauptgebäude zum Trainingsplatz trug und ihn mit Gespensterpupillen anglotzte. Der Typ drehte sich, ohne meine Schulter loszulassen, zu den Büroräumen um und rief mit metallischer Stimme über den Flur: „Isabella, kommen Sie doch mal heraus und sehen Sie, wer hier ist. Mich laust der Affe, wenn das nicht der Professor von der Anna ist.“ Eine Frau um die vierzig, im Sekretärinnenanzug und mit überdimensional hervorstehendem Busen, erschien in laut klickenden Stöckelschuhen, die Hände vor ungläubiger Verblüffung in der Luft zusammenschlagend: „Die Jungs waren noch so klein und niedlich, einfach zum Knuddeln! Aber man merkte gleich, wie ballverrückt und klug der Professor damals schon war.“ „Er war kein Junge fürs Grobe“, setzte der Platzwart hinzu, „kein Terrier, aber mit einer himmlischen Spielübersicht.“ „Und nun ist der junge Mann ein echter Führungsspieler geworden, oder? Herr Professor, Sie müssen mir unbedingt ein Autogramm geben!“
„Das Internat“, murmelte der Trainer, mir gegenübersitzend, in den Kaffeepott im überfüllten Frühstückszimmer in Marbella, „am Anfang habe ich das Internat überhaupt nicht bemerkt, nur das satte, duftende Grün der Rasenplätze, das grell-grüne Leuchten des Rasens gegen das sanft gekräuselte Licht des Himmels, der entlang der Linie, an der er die Berge und erst recht das Meer berührte, noch ausgefranster war, so wie die Ränder eines ausgetretenen Perserteppichs“. Der bittere Geschmack des Automatengesöffs, dachte ich, breitet sich gerade in seinem Rachenraum aus, ein aufbrausendes Marktstimmengewirr umfing uns, Arme und Beine widerstrebten seinem Aufstehimpuls, zogen ihn mit Bleigewichten gedanklich in sein Federbett zurück, das dem muskulösen, durchtrainierten Körper so lange nachgab, bis er auf dem Holzboden saß. Es war acht Uhr morgens, draußen räkelte sich das Meer unter dem lauten Ächzen und Stöhnen der Zottelwellen wie ein Betrunkener, der aufzustehen versucht, und stürzte jedes Mal in den roten Sand. Während ich zusammen mit dem Platzwart auf den Trainingsplatz lief, hörte ich Isabella aus der Ferne mit einer immer noch ungläubigen Bluesstimme hinter uns her rufen: „Eine Figur, genau wie im Fernsehen. Eine Figur, genau wie im Fernsehen! Eine Figur, genau wie im Fernsehen!“
Er trank den Pott aus, holte sich noch einen und setzte sich wieder auf seinen Stuhl. Er starrte in die braune Flüssigkeit und sah darin vermutlich Katrins Haarfarbe, die sich urplötzlich auf sein gesamtes Frühstückstablett, auf Tasse, Teller, Messer, Gabel und Löffel übertrug. Seit Katrins Abreise aus Marbella, ihrer endgültigen Trennung von ihm, die lange und ebenso traurige Monate vor Marbella begonnen hatte, war er daran gewöhnt, das Schiff des Lebens allein zu steuern, seine geschundenen Kräfte ausschließlich in den Verein zu stecken, das Segel der Arbeit mit dem Mut eines Mutlosen zu hissen und mit der Hoffnung eines hoffnungslos Verzweifelten einzurollen. Er war jetzt schon nach minimalen Übungseinheiten körperlich vollkommen fertig. Ich dachte, am liebsten wäre er sofort nach Hause gefahren, hätte sich in seinem Arbeitszimmer verbarrikadiert, um die Leere der Wohnung nicht zu spüren, hätte gegen seine Einsamkeit angekämpft mit der gründlichen Fortschreibung eines angefangenen Taktikkonzepts für die Rückrunde, das bislang nur aus konfusen Einzelideen bestand. Blatt um Blatt, Seite für Seite, stellte ich mir vor, würde er das Alleinsein wieder erlernen. Er würde nicht länger dasitzen und horchen, ob irgendwer seine Schritte durchs kilometerlange Treppenhaus auf seine Wohnungstür hinlenkte, sonntags überraschend anrief oder blumige E-Mails schickte. Ich malte mir aus, wie er sich daran erinnerte, in einem öffentlichen Gruß zum sechzigsten Geburtstag eines Umweltpolitikers gelesen zu haben, dass ohne Krise kein Fortschritt möglich sei, ohne Seenot kein Kapitän sein Schiff umbaue, ohne Misserfolg kein Trainer seine Mannschaft umstelle. Erst die Lebenskrise eröffne uns die Chance, dem Leben eine Wende zu geben, es völlig neu auszurichten. Dieser Gedanke, wusste ich, packte ihn und ließ ihn fortan nicht mehr los, er zwang ihn dazu, sein Lebenswerk zu überdenken, die Vereine, die er trainiert hatte oder vorhatte zu trainieren, die Spieler, die er eingekauft oder verkauft hatte oder einzukaufen plante, die in seinem Kopf verbliebenen Gedankensplitter betreffs Trainingsmethoden, Taktik-maßnahmen, Motivationskonzepten, Erfolgsgeheul und Niederlagentränen, Glücksgriffen und Todsünden, nicht zuletzt der Kardinalfrage, ob er überhaupt den richtigen Beruf habe und was danach komme.
Der Übungsplatz war eine Mischung aus Fußballfeld und Leichtathletikanlage mit einem Kabinenhaus hinter der Laufbahn, konstruiert wie ein riesiger Schuhkarton mit winzigen Fensterlöchern und eingezogenen Zwischendecken, davor eine Gruppe von Hilfstrainern, Masseuren und Betreuern, die an einem Campingtisch Skat spielten, gewissenhaft auf die Ordnung der Karten in ihrer Hand achteten wie Cheftrainer auf die Positionen ihrer Stammspieler. Der Platzwart ließ meine Schultern los und lenkte meinen Blick mit gestrecktem Zeigefinger auf einen in der Nähe stehenden bulligen Herrn: „Ihr Betreuer ist dieser Schrank da, Professor!“ Und zu dem Balljungen, der an der Seitenlinie darauf lauerte, berühmten Spielern Autogramme abzujagen, die sie mit Wegwischhänden auf vorgefertigte Bildkarten kritzelten: „Ein gelbes Leibchen. Ohne Nummer!“
Ein Leibchen ohne Nummer und Namen, etwas Unpassenderes kann mir gar nicht passieren, schimpfte ich in mich hinein, ohne das Wagnis einzugehen, ihn mit dieser Missfallensbekundung vor den Kopf zu stoßen, weil die Ablehnung einer Serviceleistung in auswärtigen Quartieren ein denkbar schlechtes Licht auf den Gast wirft, der als in hohem Maße unhöflich und undankbar gilt, und je berühmter ein Spieler ist, desto weniger Unhöflichkeit, Undankbarkeit und Unaufmerksamkeit kann er sich leisten, da der Herd der journalistischen Gerüchteküche aus dem geringsten Fehltritt eine unverzeihliche Charakterkatastrophe kocht. Der Professor hatte eine üble Kinderstube, würden die einschlägigen Blätter morgen titeln, kein Wunder, bei dem Weichei als Mutter, es fehlte die strafende, zupackende, zuschlagende, eben die väterliche Hand. Es war vor allem die Mutter, deren Interessen ich hier vertrat, wenn ich das überflüssige Stück Stoff, das außerdem stark nach Desinfektionsmittel stank, kommentarlos über mein Trikot streifte und trotz der für Januar ungewöhnlichen Wärme bis zum Schluss der Übungseinheit anbehielt, begleitet von Zufriedenheitsgesten des Betreuers. Eine altmodische elektrische Standuhr hinter einem der Tore bewegte ihre Zeiger ruckartig im Minutentakt, gerade so, als könne die Zeit in der Wintersonne nur mit bleiernen Füßen fortschreiten. Einer der Spieler trug den Ball in der Mulde zwischen Kopf und Nacken behutsam über den halben Platz wie ein bis zum Rand gefülltes Weißweinglas. Der Platzwart bemühte sich vergeblich, einen knallenden Furz als Tritt auf den Holzwollrasen erscheinen zu lassen, der partout keinen Widerhall erklingen lassen wollte, und riss dem Balljungen ein eitergelbes Leibchen ohne Nummernaufdruck, mit einem rubinroten Schriftzug des Trainingscamps auf Vorder- und Rückseite aus seinen Stöckchenfingern, die außerdem einen Satz rot-weißer Trikots sowie drei Flaschen isotonischer Getränke zu hieven hatten. Ein Herr mit Goldbrille und Bierbauch las den Skatspielern über ihre Schultern hinweg die Farben aus den abgegriffenen Karten, welk gewordenen Pappblättern, winkte aufgeregt den nassforschen Glatzkopf zu sich heran, der sich über die Einladung wie ein Honigkuchenpferd freute: „Der berühmte Professor von der Berliner Anna ist hier. Ich kenne ihn noch als Dreikäsehoch. Hatte viel mit seiner Mutter zu tun. Sooo eine Frau!“ Und er formte mit beiden Armen einen Halbkreis, der den Umfang des Bierbäuchigen noch übertraf, als wollte er die Frau aus seiner Erinnerung heraus auf dem Holzwollrasen von Marbella rekonstruieren. Der Herr mit der Goldbrille zog respektvoll seine Augenbrauen in die Stirn und sagte zu mir: „Seit Ihre Mutter nicht mehr mitfährt, Professor, ist kein Trainingslager wie früher.“
„Wie geht es der Frau Mutter, junger Mann, wie geht es der Frau Mutter, junger Mann“, hörte ich es noch in Carmens Bar widerhallen, während ich mir den zweiten Cocktail, einen alkoholfreien Carribean, bestellte. Es war noch nicht einmal neun Uhr abends, und ich fühlte mich isoliert im Team von Anna, leuteseelenallein im Wintercamp von Marbella, auf Augenhöhe mit den schroffen Bergen vor der bestirnten Silhouette eines wolkenlosen Januarhimmels, auf Ohrendistanz zu den Meereswellen, die den schwarzen Sand des verwaisten Strandes unwirsch überschwemmten. Ich legte die Beine übereinander und sah melancholisch durch die gläserne Terrassentür auf das Straßenpflaster: Seit die Frau Mutter weg ist, ist kein Trainingslager mehr wie früher, versichert der gestreifte Anzug gemäß irgendeiner dunklen Quelle seines Gedächtnisses, wird das jemals einer über mich sagen, wenn ich weggehe? Was werden Melina, mein Sohn, meine Fans, mein Trainer dann sagen, wie werden sie sich über meinen Charakter, meine Verdienste, mein Spiel äußern? Werden sie mich mit Beckenbauer oder Alves, mit Zidane oder Zecke, mit Netzer oder niemand vergleichen?
Die Kellnerin beeilte sich, den wenigen Gästen, die in den Fensternischen auf Barhockern kauerten, Kerzen anzuzünden, deren Flackern in die Dekolletees der Damen kroch, die mausgrauen Männer-Pullover zu Gespenstern machte, auf den schneeweißen Plastiktischdecken verwirrend irrlichterte. Ihr Lächeln schien mir zu verkünden: Alles wird gut, Professor, die Zukunft wird rosig sein, und mit jedem Rotwein, den ich auf Ihr Wohl trinke oder serviere, wird sie besser werden: Marco wird wieder Tore schießen, Katrin wird einen Liebhaber finden, infolgedessen wird der Trainer sich beruhigen, und Sie werden nicht auf der Ersatzbank verhungern wie das zu Hause eingesperrte, von der Rabenmutter vergessene Kind, nachdem es zwei Wochen lang vergeblich um Hilfe geschrien hat. Ja, sagte ich mir, während der Carribean ein lästiges Sodbrennen im Hals hinterließ, ich bin schneller berühmt geworden, als ich sollte.
Im Foyer des Hotels neben den beiden einander gegenüber postierten, hellgrün beleuchteten Aquarien, die dem Eingangsbereich etwas von einer Zoohandlung verliehen, flehten mich plötzlich die süchtigen Pupillen eines Mannschaftskameraden mit Irokesenhaarschnitt an: „Eine Zigarette, Professor.“ Und sofort umgarnte mich eine kindliche, bettelnde Horde in Badelatschen und Frotteemänteln, streifte meine Hemdsärmel, berührte meine Hosentaschen, tippte mit Fingern auf meinen Schultern herum, sandte ein bizarres Gemisch aus Badelotion und Saunaschweiß in meine Nasenlöcher, jammernd: „Eine Zigarette, Professorchen, nur eine Zigarette, Professorchen.“ Umzingelt von vor Erwartung strahlenden Colgate-Gebissen und grässlich breiten Mundhöhlen, die sich mit einem gierigen Crescendo öffneten und schlossen und wieder öffneten, fühlte ich mich an die Europameisterschaft 2004 in Portugal erinnert.
Es war Ende Juni oder Anfang Juli, und die Affenhitze im Hotel von Porto, wo ich tags zuvor mit der Nationalmannschaft angekommen war und mir in der ersten Nacht gegen den Turnierrummel nur einen Fingerhut voll Schlaf erkämpft hatte, legte die Nerven der Angestellten blank, die nur noch in hysterischen Schuldzuweisungen miteinander sprachen. Der bleiche Himmel, der vor Schwäche gekrümmte Asphalt, die vibrierende Luft, die alle verrückt machte, der abstoßende Fäulnisgeruch, der den Gullys entströmte, bräunten den aus England eingeflogenen Rasen, den Rasen, den der technische Direktor des Drachenstadions (Estadio Dragao) mit wütenden Fontänen, die von der gefräßigen Sonne gierig verschluckt wurden, vergeblich zu bewässern versuchte, auf dem ich die Jungen von Holland an mir vorbeilaufen sah, die ihr Nationalcoach in das Oranje-Team berufen und als Startelf nominiert hatte, damit sie in Portugal die Drogendealer, die Prostituierten und die aus Marokko eingewanderten fundamentalistischen Sprengstoffattentäter verteidigen, die das Land unter Berufung auf den heiligen Krieg in ihre Gewalt gebracht haben. Und wen würde ich im Spiel gegen sie verteidigen, wer verkörperte für mich das Heimatland? Ich hoffte auf meine Berufung in die Startformation, zählte die Minuten, die Sekunden, die mir bis zur Trainerentscheidung noch blieben, indem ich meinen Körper unter die Lupe nahm und ängstlich untersuchte wie ein Minenfeld vor der Überquerung, sah, auf der Tribüne sitzend, die Jungen von Holland auf dem löchrig-braunen Rasen an mir vorbeilaufen, roch den Schweiß des Rückenmuskulaturtrainings und ihre Angst vor dem ersten Spiel gegen das gerüchteweise athletischere, kampfstärkere Deutschland hundert Meter gegen den Wind. Unter dem Vorwand pinkeln zu müssen meldete ich mich beim Assistenztrainer ab, der damit beschäftigt war, das Feld für ein Vier-gegen-vier-Spiel mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen abzustecken, und lief in den bauchigen Kabinengang, in dem Mannschaftsarzt und Masseure den Holländern die letzten Wunden leckten, unterstützt von Betreuern, die um die Spieler herumstanden wie eine Glucke um ihre Küken. An den Wänden der ultraneuen Kabine bröckelte bereits der Lack, es stank nach einer Mischung aus Urin und Desinfektionsmittel, der den Betonfußboden bedeckende Hartfaserteppich wies knopfgroße Löcher auf, als wären sie von Zigarettenstummeln aus Verliererhänden hinein gebrannt worden. Ich hörte mich einen Moment lang um, tat, als suchte ich den Abort, blickte stehend im Kreis herum, aus den Augenwinkeln beobachtete ich die Holländer beim Taktieren, die immer noch nicht in den schallsicheren Katakomben ihres Kabinentraktes verschwunden waren, und dachte, dass sie mich nicht nach Portugal geschickt haben, um gegnerische Mannschaften auszuspionieren, sondern um sie in die Knie zu zwingen und noch vor Beendigung der Vorrunde wieder nach Hause zu schicken, vor allem die technisch versierten Holländer, sogar die favorisierten Tschechen, und erst recht die schwachen, fast nur mit Amateuren spielenden Letten. Das Überstehen der Vorrunde war die patriotische Minimalpflicht, vor der sich niemand drücken konnte, weil die wirtschaftlich angeschlagene deutsche Nation den sportlichen Kampf eines jeden brauchte, denn die Nationalmannschaft ist das Aushängeschild der Nation, der deutsche Fußballer ist von Geburt an zu jedem Triumph befähigt, vierundfünfzig, vierundsiebzig, neunzig, zweitausendsechs und so weiter, ich sah den zukünftigen Helden zu, den zukünftigen Verlierern, den zukünftigen Fußballgöttern, den zukünftigen Mistkackärschen, Prügelknaben der Nation, der joviale Chef schwor seine Millionenbeine auf den Masterplan ein, der ihm, an einem Bindfaden befestigt, vom Hals in die Spielertraube herunterhing, ich kehrte auf den Trainingsplatz zurück, nahm mir einen Ball, jonglierte ihn von einem Fuß auf den anderen. Auf einmal sahen meine Augen statt des Balles eine weibliche Brust vor mir, kurz darauf eine Vielzahl von Möpsen, die wie Trainingsbälle um mich herum auf dem Rasen verteilt waren, mich anblickten und darauf warteten, dass ich sie in Augenschein nahm, abtastete und für geil befand. Weit und breit waren keine Ehefrauen, keine Hostessen, keine Models, keine Callgirls zu sehen, nur zig Hunderte, wenn nicht Tausende wohlgeformter weiblicher Brüste, zierliche, erdbeerförmige, kuhfladenbreite, ausladende, gigantische, pralle, feste, elastische, schüchterne und forsche, die meine Blicke anzogen, so dass ich nicht wusste, wohin ich zuerst gucken sollte, die mir den Mund wässrig machten, so als handelte es sich um reife Früchte, die vom Zauberbaum einer Trainingsoase gefallen waren. Ihre rosazarten Zitzen berührten meine Schwingmembrane wie Amaretto die Zungenspitze. Ich hätte am liebsten vor Entzücken und Begeisterung gejauchzt, gejuchzt wie ein Kind im Trickkino.
„Eine Zigarette, einen Glimmstängel, einen Joint, Professor“, bettelten beschwörend die Frotteegespenster, indem sie mich bedrängten wie verfressene Spatzen. Der Irokesenkollege mit den süchtigen Pupillen versuchte mich, auf blindes Einverständnis setzend, mit einem Klammergriff von hinten zu umarmen. Ein anderer beugte seinen Oberkörper vor mir herab und steckte den Mittelfinger in den Schlitz meiner rechten Hosentasche. Ein neutraler Beobachter hätte gedacht, dass ein Schwarm exotischer, menschenähnlicher Fische aus den Aquarien herausschwamm, mich mit fieberhaften Flossenbewegungen und weit aufgerissenen Mäulern umschlängelte. Der Portier, der in seiner schuhkartonförmigen Loge über einem Kreuzworträtsel saß, ließ den Kugelschreiber auf der Stelle fallen und kam mir zu Hilfe, indem er die Angreifer mit den nach außen gekehrten Innenflächen seiner Hände auseinanderschob wie ein Schiedsrichter das erhitzte Spielerrudel. Überrascht von so viel Angestelltencourage zog ich mein Hemd wieder glatt in den Hosenbund und dachte: „Wo bin ich hier eigentlich?“
Dasselbe hatte ich zuletzt gedacht, als ich die Holländer im Kabinengang beobachtete und plötzlich nicht mehr wusste, was ich da machte, und ich dachte es manchmal in den Bars meiner brasilianischen Mannschaftskollegen, die mich gelegentlich auf einen Samba einluden. Ich fragte mich das mitunter bei offiziell anberaumten Mannschaftsessen, bei den mäßigen, aber regelmäßigen Mitgliederhauptversammlungen, in denen die Spieler von den Vereinsmitgliedern abwechselnd mit Zuckerbrot und Peitsche, Schlagsahne und Wermut abgefüllt wurden. Ich fragte es mich bei zahllosen Empfängen, Werbeaktionen und Autogrammstunden, immer dann, wenn ich ebenso stumm wie steif auf einer Konferenzbühne stand und dem Brustton geschwindelter Manager-Argumente zuhörte, die schiefer waren als der Turm von Pisa.
„Wo bin ich hier eigentlich?“, fragte ich mich auch im Ulmer Herrenkeller, während ich zum vierten Mal einen Humpen mit grasgrünem Gerstensaft leerte und eine Stubenfliege beobachtete, die sich auf das Dekolleté der Kellnerin gesetzt hatte, während sie den Zapfhahn betätigte. Nach diesem Bier würde ich zum Bahnhof aufbrechen, um den ICE Richtung Berlin zu besteigen, Richtung der Stadt, die sich zwischen verträumten Schlammseen und ägyptischer Museumsinsel hektisch hin- und her bewegte, als würde sie sonst in ihrem märkischen Sandboden versinken und nur mehr noch aus Vergangenheit, aus Legenden über verblichenen Glanz und über verblichenes Elend bestehen. Ich kramte im Innenfutter meines Jacketts nach der per Internet gekauften Fahrkarte, so wie ich im Hotel des Trainingslagers nach den Zigaretten gekramt hätte, wenn ich in ihrem Besitz gewesen wäre, im Schatten der trüben Fischbassins, an deren Glasplatten bunte Zierfische ihre Mäuler platt drückten, kleine, exotische Süßwasserwesen, Sumatrabarben, Schmetterlingsbuntbarsche, Mosaikfarbenfische durcheinander ruderten, und ich nahm ihre schillernden Farben mit auf die Treppe, die zum Büro des Hoteldirektors führte, dem vertraglich ein Begrüßungsautogramm von jedem Anna-Spieler zugesichert worden war, dem der Manager mit jovialen Hurrah-Rufen zugestimmt hatte und sich nun auf unsere Kosten darüber amüsierte, dass wir einzeln vor den Direktor traten und langsam lächelnd signierten, der uns dafür anerkennend auf die Schulter klopfte wie verschüchterten Abiturienten, die den Erhalt ihres Reifezeugnisses quittieren mussten.
Ich bin also schon wieder im Land des Schulterklopfens, sagte ich mir, während ich mit der Hand über das geadelte Schulterblatt strich, umgeben von Schulterklopfern, von Schulterklopfgefühlen, von Schulterklopfehrungen, von Schulterklopftröstungen und Schulterklopfzuwendungen, wie sie die Trainer bei jeder erstbesten Gelegenheit bereithalten, denn die Trainer meinen nur ihre Beschimpfungen und Beleidigungen ernst, ihren Spott, der sich aus der ungeheuren Angst vor Niederlagen speist, der Angst vor dem Abstieg, der Entlassung, dem öffentlichen Gespött, der Bedeutungslosigkeit. Es sieht so aus, als litten nur diejenigen unter der Angst vor dem Nichts, die sich mit ausgetüftelten Plänen nach dem unerreichbaren Alles recken, die mit ihren labyrinthischen Spielanalysen, ihren taktischen Prognosen wie Chemiker operieren, welche den genauen Ablauf ihrer Versuche im Labor vorausberechnen. Das echte Spiel ist endlos unberechenbar, ein immer neues Wagnis, das künstliche ein kaputtes, totes, weil taktisch abgesprochenes. Vielleicht klopfen sie sich deswegen auf die Schulter, dachte ich, weil Schulterklopfen wie Angstvertreiben ist. Sie erleben das Drama der Niederlage mit stoischer Gelassenheit, stolzer Anerkennung der eigenen Leistung. Ich habe noch keinen Schulterklopfer erlebt, der nach einem verlorenen Spiel geweint hätte.
Ich trat aus dem Herrenkeller in den Holzwollnachmittag Ulms mit den Donaudampfschiffen im Hintergrund und der Sonne, die fahl war wie eine drei Tage alte Leiche. Ich blieb vor der Kneipentür stehen, in der Hand das taufrische Internet-Ticket, sah die schiefen Giebel der kleinen, spitzen Fachwerkhäuser, die Menschen behängt mit Einkaufstüten, die Eisesserinnen mit ihren Schlangenzungen, die sich wollüstig um Walnusskugeln mit Mandellikör wanden, die Provinzlädchen mit ihren rotbraunen Naturholztüren, die handgefertigte Schmucksachen, Bernsteinketten, Ohrringe, Armreifen, Amulette, gewebte Sommerhosen, gebatikte Halstücher und bestickte Tischdeckchen verkauften. Gedrungene, rechthaberische Frauen führten lockenköpfige Dackel mit Leibchen um den Brustkorb durch die Gassen, Teenager in Minijeansröcken und in über die Knie reichenden Boxershorts jagten ihren Verabredungen verspätet auf Mountainbikes hinterher, die sich auf dem holprigen Altstadtpflaster aufbäumten wie wild gewordene Hengste. Kleinfamilien mit Base Cap und Picknickkorb peilten im Zick-Zack-Kurs die Frische der Donauwiesen an, auf der Suche nach einem entkrampften Nachmittagsglück. Eine erkleckliche Schlange nervöser Feierabendleute wartete an der verrosteten Anlegerstelle auf die Übersetzfähre nach Neu-Ulm, die sich mit dem Getöse eines Wassermähdreschers langsam näherte. Und oberhalb des Uferwegs, auf der roten Altstadtmauer, standen die schwäbischen Ulmerinnen und Ulmer wie vor einer Aussichtsbalustrade, sahen mit ihren weichen, den zerfurchten Gesichtern kontrastierenden Augen über die Donau auf die traurigen Neubaufassaden des bayrischen Teils von Ulm, die ins Sonnenlicht des Wassers fielen wie bittere Tränen in den süßen Most.
Ich blieb vor der Kneipentür stehen, sah zu, wie sich die bunten Fachwerkgiebel gegen das käsige Gelb des Julihimmels behaupteten, und stellte mir vor, der verirrte Ausläufer eines afrikanischen Wüstenwinds hätte den Himmel mit Sand verklebt, so wie ich in Marbella stehen geblieben war, nachdem ich das Büro des Hoteldirektors verlassen und mit der Hand über mein beklopft geadeltes Schulterblatt gestrichen hatte, zwischen Wänden, die mit goldumrahmten Fotos berühmter Gastmannschaften vollgehängt waren, und den Silhouetten neu angekommener Sportkameraden, die im Dämmerlicht der Flure nach der Klosterruhe ihrer Zimmer fahndeten, dabei flüsternd: „Endlich sind wir vor den Trainern sicher, sicher vor ihren rohen, unverschämten Ansprachen, die sie in ihren Designeranzügen auf dem Platz ausstoßen, sicher vor ihrem panischen Gebrülle und ihren krankhaft überspannten, vollkommen verrückten Erfolgsansprüchen, von denen sie sich aus Angst vor dem Misserfolg selber verrückt machen lassen.“
Wo bin ich hier eigentlich, fragte ich mich, während ich zusammen mit meinen Mannschaftskameraden zum Begrüßungsessen in den Saal hinunterging, in dem ein gigantisches Portraitbild von Edson Arantes do Nascimento, kurz genannt Pelé, von der Wand auf uns herunterblickte, das jeden neu Ankommenden sofort erschlug, ein gigantisches Gemälde, das Pelé, den größten und berühmtesten Fußballspieler der Welt, nicht als Spieler, sondern als brasilianischen Sportminister und Fußballfunktionär darstellt, als Weltbotschafter des Fußballs, mit gläsern glühenden Augen und einer strahlend weißen Zahnreihe, die Brust zugehängt mit königlichen Orden und melancholischen Medaillen, als jemand, der vom Gewicht des eigenen Ruhmes erdrückt wird.
Wo bin ich hier eigentlich, fragte ich mich, als ich aus der barmherzigen Sonne Andalusiens zurückkam, wo der Himmel die Erde erst küsst, nachdem er unzählige Orangenfelder überspannt, endlose Pinien-, Oliven- und Mandelbaumwälder überwölbt, eine unermesslich hohe Weite überflogen hat, von der ihm schwindelig geworden ist wie vom Sherry von Jerez. Wo bin ich hier eigentlich?, fragte ich mich, als ich nachts zwei Mannschaftskollegen begegnete, die, beide in volltrunkenem Zustand, in die Strafräume des Spielfeldes urinierten, in die Strafräume, weil dort, vor den Toren, wie sie durch die Sternenhelligkeit der dunklen Nacht grölten, der löchrige Rasen einer Sonderbewässerung bedürfe. Warum, fragte ich nicht etwa sie, sondern mich selbst, entfliehe ich nicht einfach dieser Fußballkaserne voller Verrückter, laufe durch das Tor, nicht etwa durch das bepinkelte Fußballtor, sondern durch das vermaledeite Eingangstor des Trainingslagers und studiere Psychologie, werde Sportpsychologe oder Kinderpsychologe, meinetwegen auch Sportlehrer, Lehrer für etwas Nützliches wie Gesundheitsförderung, Krankheitsvorbeugung, Schmerzlinderung, helfe Menschen in Krisensituationen, lindere ihre Not, unterstütze sie physisch und seelisch, warum, verflucht und zugenäht, unterziehe ich mich mit den anderen dieser gottverdammten Rosskur, mache mich zum Sklaven des Trainers, Co-Trainers und Präsidenten, befriedige letztlich nur die unersättliche Sensationsgier der Menge, die immer nur siegen und feiern, feiern und siegen will, ganz egal, wie gut oder schlecht wir spielen, wir müssen der dafür wie verrückt zahlenden Menge Erfolge liefern, für sie arbeiten wie die Berserker, für sie kämpfen wie Herakles und uns für sie den Arsch aufreißen, dass es bis nach Theben stinkt. Wir sind dazu erzogen worden, für den teuflischen Zaster bis zum Äußersten zu gehen.
Ich dachte: Die Psychologie ist die menschlichste aller Wissenschaften, denn sie schließt nichts aus. Sie kümmert sich um Körper und Seele gleichermaßen. Sie durchstreift menschliche Gründe und Abgründe zugleich, ist philosophischer Balsam und physische Medizin in einem. Sie durchleuchtet das Trübe, ohne die Klarheit zu verunreinigen, und sie erkundet das Klare, ohne die Tiefe zu vergessen. Unter Psychologen, Medizinern, Lehrern zumal ist niemand von bettelnden Frotteegespenstern belagert, deren gefräßige Mäuler vom Professor eine Zigarette, eine Zigarette, eine Zigarette erflehen, zur Not auch einen Joint oder eine gewaschene Ration Alkohol in Kauf nehmen, nach nur einem erbärmlichen Sieg mit 120 Sachen sturzbetrunken über den Kurfürstendamm rasen, denen es gleichgültig ist, ob sie nach widerlichen Zigarillos, erbarmungslosem Whisky oder fäkalienartigem Marihuana stinken. Die Psychologie ist die menschlichste aller Wissenschaften.
Ich bin in Marbella, dachte ich, ich bin in einem Lager, ich ziehe die Mannschaftsuniform an, ertrage die unerträglichen Reden des Trainers, des Präsidenten, des Platzwartes, des Hoteldirektors, weil ich gut bezahlt werde, besser bezahlt bin als die meisten anderen Bürger, ja, zu den Bestbezahlten der Nation gehöre. Ich bin Angehöriger der höchsten Gesellschaftsklasse, ich gehöre zur Schicht der Aufsichtsratsvorsitzenden, Minister, Manager, Chefredakteure und der Popstars, und sie alle akzeptieren mich mit Hochachtung, wie der durch die Boulevardblätter verdummte Pöbel mich akzeptiert, hofiert und feiert oder befeuert, aber warum sie das alle gleichermaßen tun, kann nur die Psychologie als die menschlichste aller Wissenschaften erklären. Es muss Stars, Idole und Götterbilder geben, damit die Leute im Zeitalter des Unglaubens und der Gottlosigkeit an ihren Verein glauben, ihre Fußballgötzen anbeten und das Absolute, die Macht über Sein und Nichtsein, das Schicksal des Sieges und der Niederlage auf der Haut spüren und in der Seele erleben können, eine Gewalt, die ihnen die Illusion vermittelt, auf dem Marktplatz von Ulm frei und auf der Straße Unter den Linden in Berlin voller Lebenssinn umherspazieren zu können, weil die launische Diva, die herrschsüchtige Göttin, die uneingeschränkte Königin, die Aphrodite unter den Geliebten, die gute, alte, herrliche Dame, sorgende Mutter, großzügige Tante und heilige Hure Anna bereits sehnsüchtig auf sie wartet, sie noch vor dem samstäglichen Abendessen ins Bett zieht, dazu zwingt, zwischen ihren watteweichen Schenkeln Blut und Wasser zu schwitzen, Gift und Galle zu spritzen, mit Haut und Haar in ihrer Vagina, einer steilküstentiefen Lavaspalte, zu verglühen.
Ich stand vor der Eingangstür des Herrenkellers, sog den bitteren Caféduft ein, der augenblicklich durch die Altstadt strömte und zusammen mit der von der Donau herüberwehenden Fäulnis ein Aroma annahm, das mich an meinen Geruch nach Liebesakten mit Melina erinnerte, den ich noch Tage danach in den Poren der Hände, zwischen den Oberschenkeln und unter den Achselhöhlen witterte, so wie von Hand geschälter und klein gehackter Knoblauch tagelang unter den Fingernägeln zu wittern ist, ein Geruch, der mich wehmütig an eine göttliche Nacht erinnerte, sie mit all’ ihren verrückten Pulsbeschleunigungen, märchenhaften Berührungseuphorien, lyrischen Glückswortfetzen vor meinen Augen Revue passieren ließ, so wie ich ein wichtiges Spiel, das auf des Messers Schneide stand und dank eines theoretisch unmöglichen Einsatzes, unwahrscheinlich erlösenden Tores oder zweihundertprozentig tödlichen Passes glücklich oder verdient, wer will das dann schon sagen, gewonnen wurde, in Tagträumen und in Nachtgedanken nachspielte, in bedeutungsschwangeren Badewannenminuten, zu flüchtigen Frühstückscroissants, während quälender Mannschaftsbusfahrten auferstehen ließ, um mich zu motivieren und meine Beine zu beflügeln für das nächste, wie immer wichtigste Spiel, um die aufkommende Angst davor im Keime zu ersticken, zu vertreiben wie das Gebrüll der Frotteegespenster mit ihrem ungestümen Gezeter: „Eine schäbige Zigarette, Professor, nur einen winzigen Glimmstängel, Professor, einen einzigen Joint, Professor“, Gestalten, die, sagte ich mir, in meiner Phantasie immer größer, gieriger, unverschämter werden, weil sie bereits in Marbella ganz genau, nur zu genau wussten, dass ich in meinem Leben noch nie geraucht oder gekifft habe.
©2011-2020
Eine fantastisch spannende Geschichte um einen kleinen Jungen
Ohne Zweifel ist Paul mit seinen zehn Jahren der ungewöhnlichste Pilot der Welt. Sein Großvater, zu Lebzeiten ein echter Haudegen, hatte ihm einst einen altersschwachen Doppeldecker hinterlassen, und so kann sich der kleine Junge nun in einer Welt voller Regeln und falscher Erwartungen seinen Wunsch nach Freiheit und Abenteuer erfüllen. Pauls Eltern schenken jedoch den Erzählungen ihres Sohnes keinen Glauben – natürlich. Denn zu unerhört ist die Vorstellung, dass ihr Kind selbst die schwierigsten Flugmanöver beherrscht. Und so ist Paul anfangs auf die Hilfe seiner draufgängerischen Freundin Gülcan angewiesen, als immer mehr undurchsichtige Gestalten um ihn herum auftauchen. Scheinbar besitzt Paul ohne sein Wissen etwas, das ihm diese Männer abjagen wollen. Die Schatten aus Großvaters Vergangenheit leben wieder auf, nachdem Pauls Vater unfreiwillig das besondere Talent seines Jungen entdeckt hat und die beiden an eine entlegene Hütte in den Bergen verschlagen werden. Dort gerät Paul zwischen die Fronten von zwei rivalisierenden Schmugglerbanden, die auf der Suche nach einer gefährlichen gläsernen Truhe sind. Paul erlebt, wie aus Feinden Freunde werden und wie er sich ausgerechnet auf die Menschen am meisten verlassen kann, vor denen er sein Geheimnis am sichersten verborgen hat.

Detlef Scheiber, Jahrgang 1968, studierte Sozialwesen in Würzburg und arbeitet seit 1997 in der Jugendhilfe mit den Schwerpunkten Beratung, Fallsteuerung und Krisenintervention. Er spielt Didgeridoo und tritt als Solist mit einem Perkussion-Projekt auf. In seiner Arbeit mit Menschen, in seiner Musik und in seinen Texten kommt es ihm darauf an, einengende Sichtweisen zu öffnen, neue Zusammenhänge herzustellen und die Aufmerksamkeit auf bislang unbeachtete Aspekte zu lenken. Detlef Scheiber lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Freudenberg am Main.
Detlef Scheiber: Paul hebt ab, 266 Seiten, Broschur, € 14,98, ISBN 978-3-86992-087-0
Titelbild zum Download (300 dpi)
Leseprobe:
Senkrecht gegen den Wind stieg die Lerche in den Himmel und sang dabei ihr Lied.
Die schwere Julihitze erdrückte ansonsten jeden Laut über den flimmernden Feldern.
Nur ein träger Windhauch strich über die wenigen dürren Sträucher, die Wache über ein ausgetrocknetes Land hielten. Der Sommer hatte seinen Höhepunkt erreicht, lange vorbei die Zeiten, in denen jeder Sonnenstrahl noch mit einem Lachen begrüßt wurde.
Die Hitze war zur Gewohnheit geworden, fast schon zur Last.
Gewaltig türmten sich nun die ersten Wolkenberge auf, deren überquellendes Weiß an den Rändern bereits in ein bedrohliches, schmutziges Grau übergegangen war.
Wohl gegen Abend würde das lange erwartete Gewitter losbrechen, aber noch hatte die Lerche den Himmel für sich.
Am Boden musste sie im Verborgenen leben und sich in den niedrigen Büschen verstecken, aber in der Luft war sie frei. Hier sang sie ihr Lied ohne Pause, eine verspielte, heitere Melodie. Unbeschwert ging eine Strophe in die nächste über, in vollkommener Reinheit erklang das Trällern, wurde lang anhaltend, unnatürlich gezogen, beinahe schrill. Jetzt wie eine Sirene, durchdringend und laut, ein hässliches Heulen, übertönt nur von kurzen Explosionen.
Ein schmutziger, verrußter Streifen durchzog die Wolken.
Aus einer Lücke zwischen den weißgrauen Massen schoss kurz ein alter Doppeldecker, um sofort wieder in die dichten Schleier einzutauchen.
Der Pilot kämpfte mit der Maschine, die immer schneller an Höhe verlor.
Schwarzer Qualm zog über das offene Cockpit und setzte sich auf der ölverschmierten Fliegerbrille und der ledernen Sturmhaube ab.
Auf die gläsernen Armaturen mit ihren wild kreisenden Zeigern schlug unruhig eine goldene Taschenuhr.
In kürzer werdenden Abständen gab der rauchende Motor beunruhigende Schläge von sich, hielt sich aber noch am Laufen. Flammen zuckten aus den grob vernieteten Blechabdeckungen.
Beim Austritt aus der untersten Wolkenschicht lichtete sich der Schleier und öffnete dem Piloten einen Blick über weite Felder, die bewaldeten Ausläufer des Gebirges und dahinter den großen See, der in der Sonne glitzerte.
Die Strecke über den See bis zur Landebahn an der alten Scheune würde das Flugzeug diesmal wohl nicht mehr schaffen, aber auf dieser Seite der Bergkette war keine Möglichkeit zur Landung auszumachen.
Etwas abseits standen drei Heißluftballons in der Luft und warteten auf das Auffrischen des Windes.
Auch auf die Gefahr hin, langsamer zu werden und dann wie ein Stein vom Himmel zu fallen, brachte der Pilot den Doppeldecker in Schräglage und zog in einer engen Schleife dicht an den drei Ballons vorbei, eine schwarze Spur aus Rauch hinter sich herziehend.
Beim Anblick des alten Doppeldeckers in Luftnot reagierten die Passagiere in den Körben sofort – sie zückten ihre kleinen Kameras und entfachten ein wahres Blitzlichtgewitter.
Das unruhige Knattern des Motors übertönend schrie der Pilot herüber: „Hey, hallo ihr da!“
Die Ballonfahrer ließen mit offenen Mündern ihre Kameras sinken, rief doch der Pilot aus dem kreisenden Doppeldecker mit der Stimme eines vielleicht zehnjährigen Jungen. „Hallo, ihr da drüben, gibt es hier in der Nähe einen Landeplatz?“
Ein Mann mit Glatze und Schnurrbart fand als Erster wieder aus seiner Verwunderung heraus: „Einen Landeplatz? Zum Landen?“
„Nein, zum Platzen!“, brüllte der Junge. „Wer hat euch denn hier hoch gelassen? Ach, vergesst es!“
Er schwang seine Maschine herum und steuerte auf die nahe gelegene Hügelkette zu, die sich um die Ostseite des Sees zog. Hier dürfte er genügend Auftrieb haben, um den Doppeldecker noch eine Weile in der Luft zu halten.
Der Junge schaltete schnell den brennenden Motor ab, bevor er ihm um die Ohren fliegen musste. Schlapp drehte sich der Rotor noch wenige Male, dann war nur ein unangenehmes Pfeifen zu hören.
Die Aufwinde am Berghang hielten das Flugzeug tatsächlich noch etwas in der Höhe. Dort, wo die Hügelkette abflachte, zog der Junge die Maschine im Gleitflug in einem langen Bogen um den See herum, weil er die kälteren Luftmassen über dem Wasser fürchtete.
Die Stadt schon im Blick, an deren Rand das Gehöft mit der alten Scheune und dem versteckten Landeplatz lag, steuerte der ungewöhnliche Pilot den Doppeldecker unter eine Wolke, weil er dort noch einen kurzen Auftrieb bekommen konnte.
Er wischte sich schnell über die verschmierte Fliegerbrille.
Schon oft hatte er sich bei seinen Flügen in gefährlichen Situationen befunden.
Aber noch nie zuvor war es so wichtig gewesen wie heute, die Ratschläge seines Großvaters bis ins kleinste Detail zu befolgen.
Jetzt über die ausgetrockneten Felder, um die aufsteigende Warmluft auszunutzen.
Die Landebahn noch immer unerreichbar weit.
Sein Großvater.
Von ihm hatte er diesen altersschwachen Doppeldecker geerbt.
Was hätte dieser verwegene Flieger jetzt gemacht, mit wie viel Zuversicht hätte er wohl noch die Maschine steuern können?
„Wenn du das Schicksal auf deiner Seite hast, dann brauchst du kein Glück mehr“, hatte er oft zu seinem Enkel gesagt.
Der Junge stellte die Zündung an und drückte die Nase des Doppeldeckers nach unten. Im Sturzflug begann sich der Propeller zu drehen, der Motor krachte und rauchte, bis er wieder unruhig lief und genügend Fahrt für den Landeanflug brachte.
Die ersten Gärten zogen unter den Tragflächen vorbei, jetzt noch über die Baumgruppe, dahinter lag schon die Landebahn.
Wenn sich das Flugzeug doch nur am Steuerknüppel nach oben ziehen ließe!
Ab über die Baumspitzen, ein Schlag wie eine schallende Ohrfeige am Rumpf, ein Rütteln in der Maschine, dann schwankend auf die Landebahn zugehalten.
Kurz vor dem Aufsetzen gab der Motor endgültig seinen Geist auf, viel zu schnell für eine Landung schlug der Doppeldecker hart mit dem Fahrwerk auf, hob wieder ab und stellte sich in der Luft quer. Der Junge riss das Seitenruder herum und setzte das Flugzeug schlingernd wieder auf.
Im Ausrollen zog der Doppeldecker wenige Meter vor der Scheune eine enge Kurve und reckte seine Nase in den dunklen Rauch, der über der Landebahn und der Baumgruppe lag.
Kaum dass die Maschine stand, sprang der Junge heraus, rannte über die Wiese und zwängte sich durch das alte, längst in Vergessenheit geratene Tor in die Scheune. Hier musste er noch über die sperrigen Möbel seines Großvaters steigen und kurz die Fliegerbrille und die Sturmhaube in die morsche Standuhr werfen. Vorbei an Bergen von Gerümpel stolperte er durch den vorderen Bereich der Scheune und schlüpfte durch das große Holztor hinaus.
Ein schneller Blick über den Hof mit der alten Linde, dann setzte er sich keine Sekunde zu früh auf den Mauervorsprung des gewaltigen Fachwerkhauses.
Eben bog die Mutter auf ihrem Fahrrad in den Hof, vollgepackt mit Einkaufstaschen. „Hallo Paul, wie siehst du denn aus?“
Paul strich sich eine ölverschmierte schwarze Locke aus dem verrußten Gesicht. Er wusste, dass es sich mit seiner Mutter wie mit dem Kreiselkompass in seinem Cockpit verhielt – wenn er den korrekten Kurs ansteuerte, dann drehte der Kompass genau in die entgegengesetzte Richtung. „Ich wäre beinahe mit meinem Flugzeug abgestürzt“, rief Paul. „Aber ich habe gerade noch eine Notlandung hin bekommen.“
„Ach Paul“, schüttelte seine Mutter den Kopf. „Du wieder mit deinen Geschichten. Hast du Robert beim Mofareparieren geholfen? Du weißt doch, dass dieser Umgang nichts für dich ist.“
Sie lehnte ihr Fahrrad an die Linde und nahm die Taschen herunter.
Es machte jetzt keinen Sinn, etwas richtig zu stellen.
Mehr als die Wahrheit konnte Paul ohnehin nicht sagen.
Seine Mutter trug die Taschen ins Haus und nickte ihm zu.
Paul grinste und zog den Ärmel seiner Lederjacke über die blutverschmierte Hand.
Manchmal sind Eltern einfach noch nicht bereit für die ganze Wahrheit.
Nicht für die Schule lernen wir
Frau Schmal-Wimmer ging vor der grünen Schiefertafel in die Hocke.
„Das kleine Einmaleins bietet die Grundlage für …“, sie richtete sich wieder auf und streckte die Hände an die Decke, „… das große Einmaleins. Und in Verbindung mit dem Dividieren ...“, sie teilte das Klassenzimmer mit ihrer Hand wie einen Kuchen, „... erhalten wir den Dreisatz.“
Die Kinder tuschelten angeregt durcheinander, was die Lehrerin jedoch nicht zu stören schien.
„Und wir lernen das alles für ein Leben in Freiheit und ...?"
„Selbstbestimmung“, sang die Klasse im Chor, auch wenn die Kinder mit diesen Begriffen noch nicht allzu viel anfangen konnten.
Sobald sich Frau Schmal-Wimmer zur Tafel drehte und mit quietschender Kreide ein paar Formeln aufschrieb, begannen hinter ihrem Rücken wieder die Plaudereien, die größtenteils nichts mit der höheren Mathematik zu tun hatten.
Aber Frau Schmal-Wimmer kümmerte sich nicht darum.
Wenn sie nur von Zeit zu Zeit die neuesten Lehrmethoden, die sie von ihren zahlreichen Fortbildungen mitbrachte, an den Schülern ausprobieren konnte, durfte der Lärmpegel in der Klasse gerne auch etwas höher liegen.
Nur auf eines reagierte die ehrgeizige Lehrerin allergisch.
Sie stoppte die Kreide mitten in einer Zahl und lauschte.
Dann drehte sie sich langsam um.
Aus dem allgemeinen Geschnatter hörte Frau Schmal-Wimmer etwas heraus, das ihr überhaupt nicht zu gefallen schien.
Sie horchte mit hochgezogenen Augenbrauen in die Klasse, als wäre sie ein Dirigent und müsste den Misston in einem Orchester suchen.
Fast lautlos bedeutete sie der Klasse mit hektischen Handbewegungen und zugespitztem Mund, still zu sein.
Allmählich verstummten die Kinder und es war bald nur noch von der hintersten Bank am Fenster zu hören: „D3?“ „Wasser! F2?“
„Treffer, versenkt.“
Frau Schmal-Wimmer hatte mit wenigen Schritten den Raum durcheilt und sich vor der Problembank der Klasse aufgebaut.
„Paul!“
Sie sprach den Namen des überführten Störers auf ihre besondere Weise aus, beginnend mit tiefer Stimme, dann immer höher ziehend und mit einem Überschlag am Schluss. Paul hatte dabei immer das Bild im Sinn, sein Name wäre ein Ball, der unter Wasser gedrückt wird und mit einem Plop in die Luft springt.
„Paul! Möchtest du nicht auch mit deinen Klassenkameraden in Gemeinschaft lernen?“
Dass Pauls Banknachbarin Gülcan gerade sein Frachtschiff zerstört hatte, interessierte Frau Schmal-Wimmer offensichtlich nicht. Sie nahm die beiden Blätter mit den Koordinatensystemen vom Tisch und überflog sie kurz.
„Deine Einstellung zum Lernen finde ich nicht ganz so gut. Aber ich sehe darin auch eine Chance. Du kannst deine Probleme bearbeiten und gleichzeitig etwas für die Klassengemeinschaft tun.
Würdest du bitte an die Tafel gehen und die Aufgabe anschreiben?“
Paul verdrehte die Augen, während er sich von seinem Platz drückte und nach vorne schlich.
Frau Schmal-Wimmer lehnte derweil an der hinteren Wand des Klassenzimmers. „Folgendes: Ein Auto muss, um von einem Punkt A zu einem Punkt B zu gelangen, um einen Berg fahren.
Es legt daher zu einem Punkt C1 eine Strecke von 4 km und zum Punkt B nochmals eine Strecke von 4 km zurück.
Das Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. Zur selben Zeit startet von eben diesem Punkt A ein Flugzeug.“
Paul, der schon fast an der Tafel angekommen war, blieb stehen und hörte sich erst einmal an, wie die Geschichte weiterging.
„Es fliegt über den Berg, und zwar eine Strecke von 4 km hoch zum Gipfel C2 und 8 km zum Endpunkt B. Das Flugzeug fliegt mit einer Geschwindigkeit von 180 Stundenkilometern. Wer kommt als Erstes bei Punkt B an?"
Paul hatte sich auf das Lehrerpult gesetzt. „Das ist einfach, das muss ich nicht an der Tafel rechnen. Das Auto ist schneller.“
„Was? Nein!" Frau Schmal-Wimmer stolperte nach vorne an die Tafel. „Ich meine, würdest du die Aufgabe bitte anschreiben?“
Aber Paul dachte nicht daran.
Er rutschte vom Pult herunter, und während er zu seiner Bank schlenderte, erklärte er mit den Händen in den Hosentaschen: „Der Pilot im Flugzeug muss erst alle seine Instrumente überprüfen, seinen Treibstoff berechnen und die Wettervorhersage einholen. Außerdem sollte er sich den Weg auf der Flugkarte noch einmal genau ansehen – vielleicht muss er unterwegs auf Hochspannungsleitungen oder Türme achten. Aber am längsten dauert der Steigflug. Vier Kilometer bis zum Gipfel, das ist ziemlich nah. Weil er beim Start bestimmt nicht sofort über den Berg fliegen kann, muss er noch einen Bogen in die entgegengesetzte Richtung und wieder zurückdrehen, um an Höhe zu gewinnen. Das dauert.
Bis er am Punkt B ist, hat der Autofahrer dort schon sein zweites Eis gegessen.“ Frau Schmal-Wimmer machte ein Gesicht, als sei gerade etwas sehr Trauriges passiert.
„Paul, Paul, Paul. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich. Ich muss deinen Eltern leider mitteilen, dass trotz meiner Bemühungen deine Entwicklung immer noch nicht in der richtigen Bahn verläuft.“
Dann wandte sich die Lehrerin wieder der ganzen Klasse zu.
„Aber der Rest von euch ist glücklicherweise auf dem Weg in ein Leben voll Freiheit und ...?“ Nur Justin murmelte gedankenverloren vor sich hin: „Selbstbedienung.“
Die übrigen Kinder träumten davon, ein Flugzeug mit letzter Kraft über einen hohen Berg zu steuern.
Während Frau Schmal-Wimmer nun selbst die Rechenaufgabe mit zuckenden Bewegungen an die Tafel schrieb, erklärte sie: „Natürlich kommt nicht der Autofahrer als Erstes an, das werdet ihr gleich sehen. Gleichzeitig kommen beide an, gleichzeitig.
Das ist doch auch viel besser, weil es keinen Verlierer gibt. Eine Gemeinschaft zeichnet sich überhaupt erst dadurch aus, dass es keine Verlierer gibt.“
Paul ließ sich auf seinen Stuhl fallen und schüttelte den Kopf. Von wegen gleichzeitig, als wenn er nicht wüsste, wie so ein Flug über den Berg abläuft. Paul war schließlich ein erfahrener Pilot, und er war kurz davor, den Auftrag für seinen nächsten Kurierflug zu bekommen.
Natürlich gab es 100 Gründe oder mehr dafür, dass niemand etwas von seiner besonderen Begabung wissen durfte. Aber damit konnte er umgehen.
Das Flugzeug, einen alten Doppeldecker, hatte Paul von seinem Großvater bekommen, dem wahrscheinlich wildesten Piloten, der je den Himmel durchzogen hatte.
Sein Großvater erzählte oft vom Krieg. Damals war er mit seinem Doppeldecker über die kämpfenden Soldaten geflogen und hatte Farbbeutel hinunter geworfen, bis alle Soldaten von oben bis unten bunt gefleckt waren.
Und wenn sie sich dann alle gemeinsam im Fluss die Farbe abwaschen mussten und dafür ihre Uniformen ausgezogen hatten, wusste niemand mehr, wer Freund oder Feind war, und alle lachten und bespritzten sich mit Wasser.
Und über ihnen zog der Doppeldecker seine Kreise. Ja, so ein Kerl war Großvater.
Frau Schmal-Wimmer hatte nun schon fast die ganze Tafel vollgeschrieben, um mit ihren Formeln zu beweisen, was in der wirklichen Fliegerei niemals stimmen konnte. Dabei redete sie eifrig über ihr Lieblingsthema, die freie Gesellschaft, in der jeder über sich selbst bestimmen kann.
Paul langweilte sich und starrte aus dem Fenster.
Auf der Straße traten zwei Müllmänner ihre Zigarettenstummel aus, der Fahrer hatte sich schon ins Führerhaus geschwungen. Daneben zerrte eine Mutter ihr schreiendes Kind den Gehweg entlang. Als das Müllauto losfuhr, riss sich das Kind von der Hand der Mutter und sprang auf die Stellfläche neben die Müllmänner. Das Müllauto, das Kind und die hysterisch brüllende Mutter verschwanden aus Pauls Blickfeld und gaben die Sicht auf die gegenüberliegende Straßenseite frei, wo ein großer alter Mann mit schwarzem Mantel und Hut an der Ecke wartete – wahrscheinlich auf sein Taxi. Das also war das Leben, von dem Frau Schmal-Wimmer sprach.
Da konnte sich Paul mit der Freiheit eines Piloten schon eher anfreunden, auch wenn er diese Freiheit mit niemandem teilen durfte.
Opa hatte Paul den Rat gegeben, gut zu überlegen, ob er jemandem von seinem Flugzeug erzählen soll.
„Mein lieber Paul“, hatte er gesagt, „es gibt zwei Arten von Geheimnissen.
Da gibt es die Geheimnisse, die werden dir aufgezwängt, aber sie passen dir nicht. Sie sind wie eine viel zu enge Jacke. Sie drücken dir die Luft ab.
Wenn ein Schulfreund etwas angestellt hat und dich zwingt, niemandem davon zu erzählen, dann ist das so ein Geheimnis.
Und dann gibt es noch die anderen Geheimnisse, die tun niemandem weh.
So ein Geheimnis ist zum Beispiel eine abgelegene Bucht, in der du die besten Fische angeln und zur Ruhe kommen kannst. Paul“, und dann nahm ihn sein Opa in den Arm, „bei dem Doppeldecker musst du selbst entscheiden, ob du es erzählst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann der richtige Zeitpunkt von ganz alleine kommt, an dem du es weitersagen möchtest.“
Der alte Mann mit dem schwarzen Mantel war verschwunden. Paul hatte gar nicht bemerkt, wohin.
Frau Schmal-Wimmer hüpfte wieder vor der Tafel hin und her und erklärte ihren Lieblingsschülern die Feinheiten der Dreisatzrechnung.
Wenn nur dieser Schultag endlich ein Ende finden würde.
Paul blies eine schwarze Locke aus dem Gesicht. Seine Gedanken wanderten wieder zu seinem Großvater und dem Flugzeug.
Nach Opas Beerdigung hatte er sich entschieden, das mit der Fliegerei erst einmal nicht weiter zu erzählen – schon gar nicht seinen Eltern.
Die wären möglicherweise nicht begeistert von dem Gedanken gewesen, dass ihr Junge in die Lüfte abhob.
Gerade Pauls Vater war ganz anders als Opa. Er kam immer ganz spät abends mit Anzug und Krawatte von der Arbeit und dann erzählte er, wie wichtig die Ordnung im Leben ist. Da hatte er natürlich kein Verständnis für die abenteuerlichen Geschichten von Opa.
„Wie unrealistisch!“, schnaubte Pauls Vater dann immer und wollte damit wohl sagen, dass die Geschichten des Großvaters von vorne bis hinten erfunden waren.
Aber Paul mochte es, wenn sein Großvater mit einem schelmischen Augenzwinkern von früher erzählte, und ihm war eine spannende erfundene Geschichte tausendmal lieber als eine langweilige Geschichte, die tatsächlich passiert war.
Und wer konnte es schon so genau sagen – vielleicht war an den Erzählungen von Opa doch ein Kern Wahrheit.
Trotzdem war natürlich klar, dass Paul seinem Vater, dem Paragraphen und Vorschriften so wichtig waren, erst einmal nichts von dem Doppeldecker erzählen konnte. Vielleicht gab es ja ein Gesetz, das zehnjährigen Jungen das Fliegen verbot. Man konnte nie wissen.
Und Mama machte sich sowieso über alles Sorgen. Sie wurde schon ängstlich, wenn Paul auf einen Baum kletterte oder mit der Säge arbeitete.
Und selbst wenn es für Paul noch so schwer vorstellbar war – vielleicht hätte sich seine Mutter auch Sorgen gemacht, wenn sie von seinen Flügen in dem alten Doppeldecker gewusst hätte.
Paul bekam einen Stoß in die Rippen.
Gülcan, seine Banknachbarin, zeigte ihm mit einem kurzen Nicken, was sie unter der Bank hielt.
Eine kleine gelbe Plastiktüte, wie man sie im Schreibwarengeschäft bekam, wenn man nur einen Radiergummi und einen Spitzer kaufte.
Paul grinste.
Gülcan war zwar ein Mädchen, aber dafür ganz in Ordnung.
Die anderen Jungs aus der Klasse machten immer einen großen Bogen um das vorlaute Mädchen mit den dunkelbraunen Augen, aber Paul verbrachte seine Zeit am liebsten mit ihr. Anstatt sich wie die anderen Kinder über die langweiligen Fernsehsendungen des letzten Abends zu unterhalten, konnte Gülcan selbst die spannendsten Geschichten erzählen.
Wenn Paul sein Pausenbrot mit Gülcan teilte, dann lauschte er gebannt ihren Erzählungen über ein U-Boot, das sie im See versteckte. Das U-Boot, so Gülcan, hätte früher ihrer Großmutter gehört, die eine berühmte Forscherin war und nebenbei Schätze fand und Schiffbrüchige rettete.
Paul hatte natürlich keinen Zweifel daran, dass diese Geschichten frei erfunden waren. Es war vollkommen klar, dass ein zehnjähriges Mädchen kein U-Boot besitzen konnte.
Trotzdem zeigten diese spannenden Geschichten, dass Gülcan ein echtes Abenteurerherz hatte, und Paul konnte es sich beinahe vorstellen, Gülcan im Doppeldecker mitzunehmen.
Obwohl sie ein Mädchen war!
Die Gefahr, so wusste Paul als erfahrener Pilot natürlich, bestand darin, dass man einmal ein Mädchen im Flugzeug mitnimmt und dann nicht mehr damit aufhören kann.
Das hatte ihm sein Großvater einmal mit einem Augenzwinkern erklärt. Und Paul wollte sicherlich nicht immer mit Gülcan fliegen, das war dann doch des Guten zu viel. Deshalb behielt er sein Geheimnis erst einmal für sich.
Gülcan nickte ihm noch einmal zu und Paul kramte nach Opas alter Taschenuhr. Das überhaupt Wichtigste, was Paul für die Schule brauchte, befand sich immer in seinen Hosentaschen: eine kleine Dose Feuchtigkeitscreme und Opas goldene Taschenuhr mit der seltsamen Gravur.
Alles andere konnte er vergessen, die Hausaufgaben, sein Mäppchen, aber die Uhr und die Creme mussten in der Schule unbedingt dabei sein.
Paul zog die Uhr mit der langen Kette heraus und gab Gülcan ein Zeichen, dass es losgehen konnte.
Sofort begann Gülcan, unter dem Tisch mit der kleinen Tüte zu rascheln.
Die Spielregeln waren klar: Wer am längsten rascheln konnte, ohne erwischt zu werden, hatte gewonnen.
Schon nach wenigen Augenblicken spannte sich das Gesicht von Frau Schmal-Wimmer an.
Sie redete zwar weiter, suchte aber gleichzeitig das Klassenzimmer nach diesem seltsamen Störgeräusch ab.
„Jetzt bloß nicht übertreiben Gülcan“, dachte Paul.
Die beiden Schüler der Problembank steckten ihre Hände weit unter den Tisch, die Köpfe fast auf der Tischplatte.
Kurz bevor Frau Schmal-Wimmers Blick sie erfasste wie der Strahl eines Leuchtturms hörte Gülcan auf.
28 Sekunden, dieses Mädchen hatte Nerven.
Jetzt war Paul dran.
Uhr und Tüte wechselten ihre Besitzer.
Paul hatte als Zweiter natürlich nicht mehr so viel Zeit wie Gülcan.
„Zum Donnerwetter, was ist denn das?“ Frau Schmal-Wimmer blickte streng über die Klasse, ihre mausgrauen Locken hingen noch dünner als sonst vom Kopf.
„5 Sekunden“, flüsterte Gülcan.
„Jämmerlicher Versuch.“ Sie nahm Paul die Tüte aus der Hand.
„Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht.“
„Willst du nicht wenigstens einen Moment abwarten, bis sich die Sache beruhigt hat?“, fragte Paul und kratzte sich am Kopf. Gülcan grinste: „Los, nimm die Zeit“, und sofort raschelte es wieder im Klassenzimmer.
Frau Schmal-Wimmers Gesicht bekam rote Flecken, die bis über den Hals liefen und der Lehrerin das Aussehen eines rötlich-weißen Marmorkuchens gaben. Hektisch versuchte sie, in den Gesichtern der Schüler abzulesen, wer hinter diesem unmöglichen Geräusch steckte.
Da meldete sich Gülcan, mit einer Hand frech unter der Bank weiter raschelnd. „Frau Schmal-Wimmer, bitte, hören Sie das? Da ist schon wieder dieses komische Geräusch, ich meine, es kommt von da vorne.“
„Meinst du? Ich hätte ja eher auf hier drüben getippt. Ach Kinder, jetzt seid doch mal leise.“ Die Lehrerin schaute in der vordersten Bankreihe in jede Büchertasche.
„Ich will es ja nicht übertreiben“, flüsterte Gülcan Paul ins Ohr. 43 Sekunden, unglaublich, wie abgebrüht dieses Mädchen war. Für Paul waren das jetzt ganz, ganz schlechte Voraussetzungen. Frau Schmal-Wimmer hatte ihren Unterricht abgebrochen und suchte die Büchertaschen nach etwas ab, das ein derart aufdringliches Geräusch verursachen konnte. Vielleicht sollte Paul noch die Zeit nutzen, in der sich die Lehrerin in der ersten Reihe zu schaffen machte. Er fing an.
„Paul!“
Und wieder hüpfte der Ball aus dem Wasser.
„Pauul!“ Frau Schmal-Wimmer stand noch immer vornübergebeugt an einer Tasche, schaute aber zwischen ihren Beinen quer unter den Tischen der Klasse auf Pauls gelbe Einkaufsrascheltüte.
So schnell konnte man nicht schauen, wie die Lehrerin durch das Klassenzimmer vor die Problembank sprang. Gülcan hatte gerade noch Zeit, die Uhr in ihre Tasche rutschen zu lassen.
„Paul, wusste ich es doch!“
Was für ein Glück war Frau Schmal-Wimmer eine verständnisvolle Lehrerin, die alle, wirklich alle ihre Schüler liebte und ihnen nur das Beste wünschte, sonst hätte sie nämlich diesen frechen Bengel an den Haaren gepackt, ihn in die Besenkammer gesperrt, ihn barfuß durch die Bubentoilette laufen lassen, ihm den Kopf in einen Mädchenturnbeutel gesteckt oder was der Lehrerin sonst noch so alles einfiel, wenn sie abends auf dem Heimtrainer saß und sich die Wut über diesen Lehrerschreck abstrampelte.
Aber glücklicherweise war Frau Schmal-Wimmer eine einfühlsame, verständnisvolle Lehrkraft, die ihre Schüler auf ein Leben in der Gemeinschaft vorbereiten wollte.
„Du kommst jetzt sofort mit, du fiese kleine Kröte, mal sehen, was der Schulleiter zu deinem unmöglichen Verhalten meint!“
Mit diesen Worten rauschte Frau Schmal-Wimmer durch die Klasse und zur Tür hinaus. Paul schaute sich erst noch kurz um, folgte dann aber der Lehrerin und musste dabei ordentlich Tempo machen, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Jetzt auch noch mit lässiger Langsamkeit aufzufallen, war nicht ratsam. Durch die leeren Gänge und zwei Treppen hoch hetzte Paul hinter Frau Schmal-Wimmer her, die mit geballten Fäusten zum Direktorat dampfte. Auf einen Schritt der Lehrerin musste Paul fünf eigene machen.
Ohne anzuklopfen stürmte Frau Schmal-Wimmer in das Zimmer von Rektor Süß, Paul atemlos hinter ihr her stolpernd.
„Es reicht, Chef. Dieser Junge hier macht nicht nur alles, um sich selbst aus der Klassengemeinschaft auszuschließen, er behindert auch noch die Mitschüler, gute Leistungen zu erzielen.“
„Na, na, so schlimm kann unser Paulchen doch gar nicht sein.“
Rektor Süß stellte die Gießkanne neben seine Zimmerlilie und kam um den Schreibtisch gewackelt. Er hatte die Angewohnheit, den großen und kleinen Übeltätern, die zu ihm ins Büro gebracht wurden, mit Daumen und Zeigefinger in die Wange zu kneifen.
„Wir waren doch alle einmal Lausejungs, nicht wahr?“
Mit diesen Worten griff er nach Pauls Wange, rutschte aber gleich wieder mit den Fingern ab.
„Niemals die Creme vergessen“, dachte Paul.
Rektor Süß blickte irritiert zu Frau Schmal-Wimmer, dann versuchte er noch einmal, Paul in die Wange zu kneifen und wieder fanden die Finger keinen Halt.
„Vielleicht braucht der Junge nur eine engmaschigere Betreuung?“
Diesmal rutschte Rektor Süß an der anderen Wange ab.
Bei der vorangegangenen Jagd hinter seiner Lehrerin durch das Schulhaus hatte Paul zwar Mühe, das ganze Gesicht einzucremen, aber es hatte sich letztendlich doch gelohnt.
Rektor Süß rutschte mit den Fingern an beiden Wangen gleichzeitig ab. „Dieser Flegel ist ja die Heimtücke in Person, Frau Kollegin. Sie müssen ihn unbedingt beispielhaft zurück in die Gemeinschaft führen. Was schlagen Sie als Sanktion vor?“
Frau Schmal-Wimmer schaute mit verschränkten Armen auf Paul.
„Nun, ich hatte da an die Karten gedacht.“
Rektor Süß zog die Augenbrauen hoch.
Ein Problem seiner Schule bestand darin, dass die Klassen auf die Stadt und einige Dörfer ringsum verteilt waren. Freitags waren die Karten für den Erdkundeunterricht noch im Haupthaus.
Am Montag früh wurden sie in der ersten Stunde in einer entlegenen Nachbargemeinde gebraucht.
Die Lehrer drückten sich gerne um diese zusätzliche Fahrt, weshalb die Karten als beliebte Strafe, Frau Schmal-Wimmer würde sagen Konsequenz, für aufsässige Schüler dienten.
Weil die Karten zu sperrig für den Transport auf dem Fahrrad waren, mussten die Übeltäter eine wahre Odyssee mit dem Bus einschließlich langer Wartezeiten über sich ergehen lassen und bekamen dabei die Gelegenheit, über ihr Fehlverhalten nachzudenken.
Hatten sie dann endlich das kleine Dorf mit der Außenstelle der Schule erreicht, war natürlich kein Lehrer mehr im Dienst. Die Karten wurden dann von einem schrulligen alten Pfarrer in Empfang genommen, der meist sehr unwirsch mit den reumütigen Schülern umging.
Eine höchst unangenehme Begleiterscheinung dieser Art der Bestrafung war zudem, dass sie sich mittlerweile herumgesprochen hatte und jeder Bescheid wusste, der am Wochenende ein Kind mit einem unhandlichen Paket an der Bushaltestelle stehen sah.
Die Mütter und Väter wurden in den Elternbriefen regelmäßig dazu angehalten, ihren Kindern diese Erziehungsmaßregel nicht mit dem Auto zu erleichtern.
„Eine großartige Idee, Frau Kollegin. So kann unser kleiner Quertreiber seine Schulden am Gemeinwohl ausgleichen, indem er seine freie Zeit am Wochenende opfert.“
Paul zeigte keine Regung.
Am Wochenende sollte es schön warm werden, seine Klassenkameraden würden sich bestimmt im Schwimmbad treffen.
Keine Hausaufgaben, stattdessen Sonne und wolkenloser Himmel.
Paul unterdrückte ein Grinsen.
Beste Flugbedingungen.
Es hatte diesmal wirklich ungewöhnlich lange gedauert, bis Paul seinen Kurierflug mit den Karten in der Tasche hatte, aber zum Schluss war dann doch alles nach Plan gelaufen.
Wenn Paul selbst bestimmen konnte, was die Lehrer zu machen hatten, dann war das mit der Selbstbestimmung eine großartige Idee.
Dann konnte Frau Schmal-Wimmer voll und ganz mit Paul rechnen.
Der höchst eigentümliche Pfarrer Vierneisel
Wenn Frau Schmal-Wimmer gewusst hätte, welche Vorbereitungen ein geheimer Flug an einem Samstagvormittag benötigt, dann hätte sie ihren gesamten Mathematikunterricht über den Haufen werfen müssen.
Die Flüge zum alten Pfarrer Vierneisel, bei dem die abgestraften Schüler die Karten abgeben mussten, waren deutlich anspruchsvoller als alle anderen Unternehmungen zusammen.
Das lag hauptsächlich daran, dass Paul sich unbemerkt von seinen Eltern davon stehlen musste, was an einem gewöhnlichen Wochentag natürlich viel einfacher war als an einem Wochenende.
Gerade samstags fiel es der Mutter seltsamerweise immer ein, dass Paul wieder einmal sein Zimmer aufräumen könnte.
Und Pauls Vater bekam regelmäßig an den Wochenenden so merkwürdige Ideen, das Vater-Sohn-Verhältnis besonders herauszustellen. „Mein Junge, heute zeige ich dir wie man …“
Mit diesen Worten begann der Vater meistens die unvermeidliche Katastrophe, in deren Verlauf er Paul zum Beispiel den Ausbau einer Lichtmaschine am Auto oder ähnlich heikle Aktionen vorführte.
Paul stellte sich dann immer daneben und musste sich arg beherrschen, seinem Vater nicht ständig zu erklären, welch groben Unfug er da mit seinem Auto anstellte.
Meistens gingen diese Vater-Sohn-Geschichten so aus, dass Pauls Vater gegen Nachmittag kleinlaut nach einer Werkstatt suchen musste, die den angerichteten Schaden wieder in Ordnung brachte.
Unter diesen verschärften Bedingungen an den Wochenenden war natürlich eines völlig klar: Bevor Paul zum Pfarrer Vierneisel fliegen und dort die Karten abliefern konnte, musste er seine Eltern ausreichend beschäftigen.
„Papa, wie erkläre ich in der Schule am besten den Begriff Struktur?“
Pauls Vater schaute nicht einmal hinter seiner Zeitung hervor.
„Struktur, mein Sohn, ist das überhaupt Wichtigste im Leben. Sie ist wie ein tragendes Gerüst, oder wie ein fester Fahrplan, der alle Abläufe regelt.“
„Dann ist also die Art, wie Mama die Hausarbeit macht, ein gutes Beispiel für Struktur?“
Dafür bekam Paul von seiner Mutter, die gerade das Besteck abräumte, ein Lächeln.
Sein Vater hatte nun die Zeitung zusammengefaltet und lehnte sich, die Kaffeetasse wie einen Zeigestock schwingend, zurück.
„Interessant, dass du gerade das ansprichst. So, wie deine Mutter nämlich den Haushalt führt, fehlt tatsächlich jegliche Art von Struktur.“
Pauls Mutter ließ die abgeräumten Teller mit einem lauten Knall auf die Arbeitsplatte fahren. „Was soll denn das heißen?“, bellte sie. „Ich glaube, ich höre nicht recht!“
„Aber Liebling, bitte, das kann man doch auch ganz sachlich diskutieren. Und wenn der Junge und du dabei noch etwas lernt, dann haben wir alle etwas davon. Schau mal Paul, deine Mutter hat eben noch die Arbeitsplatte abgewischt und stellt jetzt das schmutzige Geschirr darauf. Strukturiertes Vorgehen würde aber bedeuten, dass sie erst ...“
„Ich räume wenigstens ab und lasse mich nicht wie der werte Herr von vorne bis hinten bedienen! Unglaublich! Erst muss ich mir sagen lassen, ich wäre mit meinem Haushalt überfordert, und dann soll ich auch noch hübsch freundlich bleiben. Möchten der Herr vielleicht noch eine Tasse Kaffee?“
„Oh ja, danke, das wäre nett. Wobei wir hier, Paul, zu einem weiteren anschaulichen Beispiel für meine Ausführungen kommen: dem Verschluss auf der Kaffeekanne.“
Pauls Vater angelte sich die Kanne vom Tisch und drehte sie in der Hand wie einen seltenen Brocken Mondgestein.
„Dieser Verschluss ist in unserem Haus genau wie der Deckel auf dem Honigglas nie gerade zugeschraubt, sondern verkantet im Gewinde. Ein planvolles, strukturiertes Vorgehen würde dagegen sicherstellen ...“
Während der Vater weiter schulmeisterte und sich dabei um Kopf und Kragen redete, beobachtete Paul die letzten Warnsignale seiner Mutter, die kerzengerade mit zurückgezogenen Schultern mitten in der Küche stand und langsam tief Luft holte.
Jetzt erinnerte sie Paul an eine Rakete kurz vor dem Start: Fünf, Vier, Drei, die Gerüste fielen rechts und links zur Seite, Zwei, Eins, die Triebwerke wurden gezündet, Rauchschwaden verhüllten die Sicht.
Das war genau der Moment, an dem sich Paul unbemerkt aus der Küche stehlen konnte.
Er wusste, wie es jetzt weitergehen würde: eine lautstarke Gardinenpredigt, in der seine Mutter ohne Punkt und Komma seinem Vater alles um die Ohren hauen würde, was sie die Woche über im Haushalt alles macht, während der „Herr Superwichtig“ es sich im Büro gut gehen ließ.
Papa würde immer hilfloser beschwichtigen, bis er einsah, dass er bis zum Äußersten gehen musste. Er würde Pauls Mutter dann fragen, ob sie nicht gemeinsam in die Stadt zum Einkaufen gehen möchten. Diese Wiedergutmachung schaffte genügend Zeit für den Flug zum Pfarrer Vierneisel.
Paul schlich sich über den Hof in die alte Scheune.
Im hinteren Bereich, dort wo kaum noch Licht vom großen Tor einfiel, standen der alte Rasenmäher, die Spielzeugeisenbahn und viele andere Dinge, die Pauls Vater irgendwann einmal bei seinen „komm Junge, ich zeig dir mal wie...“ Aktionen ruiniert hatte.
Weil Mutter immer schimpfte, dass diese Sachen endlich einmal repariert gehören, machte Papa einen großen Bogen um diesen Teil der Scheune und Paul konnte sicher sein, dass sein Flugzeug hier unentdeckt bleiben würde.
Paul holte die in einem schwarzen Leinensack verstauten Karten unter einem Stapel Kisten hervor.
Hier hatte er sie versteckt, damit seine Eltern keine peinlichen Fragen über die Schule stellen konnten.
Dann stieg er über die alten Möbel seines Großvaters und öffnete das verwitterte hintere Scheunentor, das von seinen Eltern schon lange nicht mehr benutzt wurde. Auf der Rückseite der Scheune lag die große Wiese, die Paul als Start- und Landebahn diente. Hier stand der Doppeldecker.
Im Morgengrauen, als die Eltern noch schliefen, hatte Paul das Flugzeug aus der Scheune gerollt und noch einige wichtige Reparaturen erledigt.
Paul klopfte zärtlich auf das Heck.
Es war ein wunderschöner Doppeldecker, dunkelgrün und schwarz lackiert, auf beiden Seiten glänzte jeweils ein Wappen mit einem brüllenden Bärenkopf.
Der Rumpf der Maschine hatte etwas Ähnlichkeit mit einer Walze, kurz und dick, zum Heck hin spitz zulaufend. Der Bug dagegen wurde bestimmt von dem mächtigen Motorblock und dem hölzernen Propeller.
Großvater hatte lange vor Pauls Geburt einen Zündmechanismus eingebaut, mit dem er den Motor auch alleine zum Laufen bringen konnte.
Als sie dann gemeinsam unterwegs waren, konnte der alte Mann den Propeller andrehen, während sein Schüler im Cockpit saß und die Maschine startete.
Jetzt war Paul alleine.
Er überprüfte die Instrumente und befestigte Großvaters goldene Taschenuhr am Armaturenbrett. Drei Symbole waren auf die Innenseite des Deckels eingraviert, darunter die Worte: mit Mut, mit Können, mit Liebe.
Paul stellte die Zündung ein, sprang vor das Flugzeug und drehte den Propeller erst ein paar Mal langsam in die entgegengesetzte Laufrichtung. Dann wuchtete er den Propeller schnell herum.
Nach dem dritten oder vierten Versuch sprang der Motor an und tuckerte von selbst vor sich hin.
Paul kletterte zurück ins Cockpit, setzte die Sturmhaube und die Fliegerbrille auf und gab vorsichtig Gas.
Der Doppeldecker war schon über 90 Jahre alt, und obwohl Paul erst vor ein paar Tagen den Motor auseinandergenommen, gesäubert und wieder zusammengesetzt hatte, rüttelte die Maschine ganz fürchterlich, als sie sich in Bewegung setzte.
Immer weiter schob Paul den Gashebel nach vorne und die Maschine beschleunigte auf dem Feld. Den Gashebel am Anschlag schoss das Flugzeug über die Wiese.
Jetzt den Steuerknüppel vorsichtig an den Bauch ziehen und abheben.
Sofort verstummten das nervige Quietschen der Räder und das Schleifen des Hecksporns auf der Wiese. Nur noch das Pfeifen des Windes und das monotone Auf und Ab des Motors waren zu hören.
Paul liebte den Start, das Kribbeln im Bauch und den Druck auf den Beinen, wenn der Doppeldecker nach oben stieg.
Die Welt unter ihm wurde kleiner und unbedeutender.
Er fühlte sich frei.
Nach wenigen Minuten hatte er seine Flughöhe erreicht und brachte die Maschine auf Kurs zum Pfarrer Vierneisel.
Die Felder zogen langsam unter ihm vorbei, im Süden lagen schimmernd der große See und dahinter das Gebirge. Paul malte sich oft aus, welche Länder wohl hinter den Bergen liegen mussten. Spannende Abenteuer gab es dort sicher zu bestehen und Paul nahm sich vor, irgendwann einmal über das Gebirge zu fliegen.
Irgendwann einmal, aber nicht heute. Heute brachte er die Karten zum Pfarrer Vierneisel. Auf und ab dröhnte der Motor und der Wind wehte um Pauls Gesicht.
Der Doppeldecker war früher als Schulungsflugzeug im Einsatz gewesen, deshalb gab es zwei hintereinanderliegende Cockpits. Paul saß hinten, vorne war Platz für die unhandlichen Karten.
Bei seinen ersten Flügen hatte Paul seinen Platz noch vorne einnehmen müssen, während sein Großvater die Maschine vom hinteren Cockpit aus steuerte und durch den Fluglärm all das nach vorne brüllte, was gerade besonders wichtig war.
Irgendwann einmal durfte Paul dann im hinteren Cockpit sitzen und das Flugzeug selbst steuern.
Großvater gab dann nur noch ein paar wenige Anweisungen, denn Paul war ein gelehriger Schüler, der schnell die Kunst des Fliegens beherrschte.
Die ersten Flüge zum Pfarrer Vierneisel mit den Karten hatte Paul noch mit seinem Großvater zusammen unternommen. Nach der Landung blieb der alte Haudegen aber immer beim Flugzeug und schickte Paul alleine mit den Karten zum Pfarrer.
„Besser, wenn ich hier bleibe“, meinte Großvater dann immer.
„Der alte Vierneisel kennt mich gut und er würde bestimmt erraten, auf welche Weise wir zu ihm gekommen sind.“
Die ersten Flüge zum Pfarrer Vierneisel nach Opas Beerdigung waren für Paul natürlich sehr schlimm. Er konnte nicht glauben, dass nun niemand mehr an der Maschine auf dem Feld wartete, nachdem er die Karten abgeliefert hatte.
Weil sich aber Großvater und der Pfarrer Vierneisel von früher wohl so gut kannten, hatte Paul nach einiger Zeit das Gefühl, mit den Besuchen im Pfarrhaus auch wieder etwas von Opas Geschichte aufleben zu lassen.
Der Flug bei diesem herrlichen Sommerwetter war das reinste Kinderspiel.
Paul schaute rechts am Motor vorbei und erkannte auch schon bald den Kirchturm. Er lenkte sein Flugzeug in eine leichte Kurve, damit er den möglichen Landeplatz erst einmal überfliegen konnte.
„Jeder Buschpilot“, so hatte ihm sein Opa beigebracht, „fliegt erst einmal über die Landebahn und schaut nach, ob sie auch in Ordnung ist.“
Paul ging meistens auf einem Feld abseits des kleinen Dorfes herunter, weil er dort durch eine Reihe großer Hecken vor neugierigen Blicken geschützt war. Aber natürlich musste er immer überprüfen, ob nicht gerade ein Bauer unter ihm bei der Arbeit war.
Am Wetterhahn der Dorfkirche konnte Paul die Windrichtung absehen und dann mit einer sanft gezogenen Kehre zur Landung auf dem Feld ansetzen.
Je mehr er mit zurückgenommenem Gas an Höhe verlor, umso schneller zogen die Felder und Büsche an ihm vorbei. Nur noch ein paar Meter bis zum Boden, Paul nahm das Gas weg, zog die Nase des Flugzeuges etwas nach oben und setzte sanft auf.
Sofort begannen die Räder wieder zu quietschen und Paul lenkte das knarrende Flugzeug an die große Hecke, stellte den Motor ab, packte sich die sperrigen Karten auf den Rücken und machte sich auf den Weg.
Nach einigen 100 Metern ging ein Pfad durch die Hecken an zwei Bauernhöfen vorbei ins Dorf.
Paul schlug den Weg zur Kirche ein.
Niemand war auf der Straße, nur vor dem Pfarrhaus stand ein dunkles Auto, in dem ein Mann mit einem schwarzen Hut saß.
An der Eingangstür des Pfarrhauses klopften zwei Männer ungeduldig gegen das Holz.
Paul versteckte sich hinter einer Hausecke.
Wenn die Männer die Landung des Doppeldeckers hinter der Hecke beobachten konnten, dann sollten sie nicht einen kleinen Jungen aus eben dieser Richtung kommen sehen.
Die beiden Männer an der Pfarrhaustüre hatten es wohl aufgegeben, weiter zu klopfen.
Sie stiegen in das Auto zu dem wartenden Mann und fuhren los. Nachdem der dunkle Wagen mit quietschenden Reifen um die Ecke gebogen war, kam Paul wieder aus seinem Versteck.
Der alte Pfarrer war offensichtlich nicht in seinem Haus, deshalb ging Paul gleich durch das schwere eisenbeschlagene Tor in den Pfarrgarten.
„Hallo, Herr Pfarrer?“ Der große Pfarrgarten war leer, nur von einem der hinteren Obstbäume kam ein Rascheln.
„Herr Pfarrer Vierneisel, hallo, sind Sie da?“
„Ja kann man denn nicht einmal in Ruhe von seinem Baum fallen!“
Paul musste zweimal nachschauen, woher diese krächzende Stimme kam.
Hoch oben auf einem der letzten Bäume, knapp vor der Dorfmauer, saß ein kleines Männlein, drückte sich immer wieder mit den Händen ab und ließ sich dann mit dem Hinterteil auf den Ast fallen. Der alte Pfarrer Vierneisel.
Beim Näherkommen erkannte Paul, dass sich der Pfarrer in einem besorgniserregenden Zustand befand. Das Gesicht blutverschmiert, über die Halbglatze zog sich eine lange Narbe.
Die schwarze Kutte war eingerissen und hing an manchen Stellen in Fetzen vom Körper. Der früher einmal weiße Kragen war dunkel von Blut und Dreck.
„Ist alles in Ordnung, Herr Pfarrer?“ Paul hatte die Karten an den Baum gelehnt und suchte den besten Blick nach oben durch die Äste.
„Nichts ist in Ordnung, jetzt geh weg da unten, nicht dass ich noch auf dich drauf falle.“
„Kann ich Ihnen nicht irgendwie helfen?“
„Doch natürlich, du kannst mir helfen, wenn du nur noch etwas da vorne am Tor wartest.
Wenn ich vom Baum gefallen bin, dann kann ich dich gut gebrauchen. Du könntest mir als Zeuge zur Seite stehen.“
Und mit diesen Worten sauste er wieder auf den Ast.
„Ich glaube, ich hole dann mal jemanden.“ Paul wandte sich dem Pfarrhaus zu.
„Halt, halt, halt, du musst dir keine Sorgen machen!“, rief der Pfarrer von oben herunter. Paul setzte sich in Bewegung.
„So ein unbelehrbarer Bengel!“ Flink kletterte der alte Pfarrer Vierneisel vom Baum, humpelte Paul hinterher und legte ihm keuchend die Hand auf die Schulter.
„Das wäre jetzt, na sagen wir mal, etwas ungünstig, wenn mich meine Schäfchen in diesem Zustand sehen könnten.“
Paul blickte den Pfarrer regungslos an. Er hatte schon oft die Karten abgeliefert, und seltsam war der Pfarrer Vierneisel eigentlich auch schon immer gewesen, aber so hatte ihn Paul noch nie erlebt.
„Was ist denn bloß mit Ihnen passiert? Soll ich nicht doch besser Hilfe holen?“
„Nein, auf gar keinen Fall! Mach dir keine Sorgen. Es handelt sich hierbei“, und er hielt einen Fetzen seiner Kutte hoch, „doch nur um die Folgen einer kleinen naturkundlichen Expedition.“
„Ich ruf dann mal einen Krankenwagen.“
„Aber wieso denn?“
Pfarrer Vierneisel war schnell um Paul herum gehuscht und versperrte ihm nun den Weg zum Pfarrhaus. Paul blickte ihm fest in die Augen. Nach einer Weile ließ der alte Mann die Schultern sinken. Er überlegte kurz, dann holte er tief Luft und sagte zu Paul: „Na gut, ich will es dir erklären. Es wäre aber nett, wenn du die Geschichte für dich behalten könntest. Es gibt überhaupt keinen Grund, alles an die große Glocke zu hängen, verstehst du? Aber du scheinst mir ohnehin geübt im Umgang mit Geheimnissen, oder?“
Bei dem „oder“ zog der alte Pfarrer nur eine Augenbraue hoch.
Jetzt konnte Paul seinem Blick nicht mehr standhalten. Er schaute auf den Boden und kratzte mit den Schuhen in der Erde herum.
„Hol die Karten, du bekommst im Pfarrhaus eine Limonade. Vom Baum fallen kann ich später immer noch.“ Pfarrer Vierneisel drehte sich um und humpelte mit auf dem Rücken verschränkten Armen zum Tor des Pfarrgartens.
Paul eilte sich, die Karten am Baum zu holen und hinter dem Pfarrer her zu kommen. Während Paul noch nach Luft suchte, begann Pfarrer Vierneisel seinen Vortrag: „Eine der bemerkenswertesten Vogelarten überhaupt ist doch wohl die Schleiereule, nicht wahr? Alleine über die Anordnung ihrer Kopffedern könnte ich dir stundenlang berichten.
Aber nun gut. Wir haben das seltene Glück, derzeit eine junge Brut dieser außergewöhnlichen Vögel in unserer Gemarkung zu haben, und zwar in der Scheune vom alten Bauern Zinsmeier.“
Pfarrer Vierneisel und der neben ihm herschnaufende Paul hatten das Tor des Gartens erreicht und gingen von hier aus quer über den gepflasterten Platz zum Pfarrhaus.
„Nun kümmert sich dieser störrische Bauer aber in keinster Weise um das wunderbare Schauspiel, das sich da unter dem Dach seiner Scheune zuträgt, und deshalb muss eben ich regelmäßig nach dem Rechten sehen.
Der alte Quertreiber weiß natürlich nichts davon, dass ich in seiner Scheune herumklettere, und das soll auch so bleiben. Der hätte sowieso kein Verständnis dafür, dass man sich auch um Tiere, die man nicht essen kann, kümmern muss.“
Pfarrer Vierneisel stieg die Treppen zum Pfarrhaus hoch und zog dabei sein linkes Bein auffällig nach.
„Heute Nacht nun war ich wieder in der Scheune bei den Eulen und dabei bin ich vom obersten Balken abgerutscht, durch den morschen Bretterboden geschlagen und in die Schnapsbrennerei gestürzt, die der alte Zinsmeier unten in seiner Scheune stehen hat.
Muss wohl ziemlich laut gewesen sein, denn gerade als ich wieder zwischen all den Flaschen mit Zinsmeiers bemerkenswertem Obstbrand zu mir kam, da rannte auch schon der Alte vom Haupthaus mit einer Schrotflinte im Anschlag auf die Scheune zu. Wo ist denn nur dieser Schlüssel?“
Pfarrer Vierneisel suchte in seinem zerrupften Umhang nach dem Schlüssel für das Pfarrhaus.
„Da es allerdings nur zu Missverständnissen führt, wenn mich der alte Zinsmeier in diesem Zustand in seiner Schnapsbrennerei erwischt, bin ich also geflüchtet, so schnell mich meine alten Beine noch tragen konnten. Aha, da ist er ja.“ Pfarrer Vierneisel schloss die Tür zum Pfarrhaus auf, blieb aber noch auf der Schwelle stehen und beugte sich zu Pauls Ohr hinunter: „Und weil ich natürlich eine Erklärung für meinen im Moment etwas unangemessenen Zustand brauche, will ich von einem meiner Obstbäume fallen. Wenn es mich nur ordentlich durch die Äste haut, muss ich nichts Falsches sagen, wenn man mich nach meinen jüngsten Verletzungen fragt. Und niemand bringt mich mit dem nicht ganz so offiziellen Besuch in der Scheune vom Zinsmeier in Verbindung.“
Pfarrer Vierneisel verschwand im dunklen, kühlen Gang des Pfarrhauses.
Paul hatte die schweren Karten auf der obersten Stufe abgesetzt und atmete erst einmal durch.
„Aber Herr Pfarrer, brüten die Schleiereulen nicht im Frühjahr?“
Drinnen im Pfarrhaus hörte man etwas klappern und auf den Boden fallen, dann erschien das Gesicht vom alten Pfarrer Vierneisel wieder im Gang.
„Natürlich, natürlich, nur handelt es sich bei den Eulen in der Scheune um eine sehr seltene Unterart, nämlich um den so genannten augustbrütenden Destillenkauz. Und gerade weil er so selten ist, benötigt er eben besondere Pflege und Fürsorge. Aber was weißt du denn schon. Komm in die Küche, da bekommst du deine Limonade und gut ist. Wo ist denn die Mamsell, wenn man sie mal braucht?“
Weil die dicke Haushälterin nirgends zu finden war, ging Pfarrer Vierneisel selbst in die Küche und kam mit einer Limonadenflasche und zwei Gläsern wieder heraus.
Paul ging wie immer bei seinen Besuchen im Pfarrhaus die vielen Fotografien im Gang ab. Da sah man vornehm gekleidete Geistliche in prunkvollen Kirchen, aber auch ein einfaches Holzkreuz inmitten von Lehmhütten, Bilder von lachenden dunkelhäutigen Kindern und alten Menschen, die ein wenig wie Indianer aussahen.
Eine Fotografie fesselte Paul besonders: ein Schwarz-Weiß-Bild, eher schon ins Rostrote übergehend, mit drei alten Flugzeugen auf einem Feld.
Ganz links ein heller Eindecker, der Pilot, der ab der Brust aus dem fast wie ein Holzbalken wirkenden Rumpf schaute, war beinahe die einzige Erhebung des Flugzeuges. Nur vorne am Bug war ein winkelartiges Gestell montiert, durch das die Verstrebungen für die Flügel liefen.
Daneben ein Doppeldecker mit weit ausladenden Tragflächen, die Nase war an der Unterseite abgeflacht, so als hätte man ein Stück des Motorblocks schräg abgesägt.
Und auf der rechten Bildseite der Doppeldecker, den Paul so gut kannte, mit wuchtigem Motor, kurzen Flügeln und walzenförmigem Rumpf.
Auf allen drei Flugzeugen war das Wappen mit dem Bärenkopf gemalt.
Die drei jungen Piloten lachten den Betrachter des Bildes fröhlich an.
Besonders verschmitzt wirkte der Pilot in Pauls Doppeldecker.
„Dein Großvater war ein ganz besonderer Mensch.“ Pfarrer Vierneisel stand hinter Paul und betrachtete ebenfalls das Bild. Seltsam nachdenklich wirkte er dabei.
„Ich habe später noch gute Männer gesehen, aber niemals bessere als diese drei.“ Paul kannte die Geschichte zu diesem Bild.
Die beiden Piloten neben Großvater waren der Oberst und Doktor Capello. Großvater und der Oberst gingen zusammen in eine Flugschule und lernten dort den Doktor kennen.
„Jetzt komm in die Stube“, drängte der Pfarrer.
„Du musst mir einiges erzählen.“
Im Wohnzimmer setzte sich Pfarrer Vierneisel in seinen Ohrensessel und legte die Füße auf einen Holzschemel.
„Was hast du denn diesmal angestellt, dass du die schweren Karten bringen musst?“
Paul nahm sich ein Glas Limonade, setzte sich auf einen Stuhl und erzählte dem grinsenden Pfarrer Vierneisel vom Schiffe versenken, von der verhauenen Rechenaufgabe und von Gülcans Raschelpapier.
„Unglaublich, wie sehr du deinem Großvater ähnelst. Der konnte auch nicht machen, was er sollte und ständig hatte er nur Unfug im Kopf. Na und die beiden anderen Männer waren auch nicht viel besser.“
„Aber der Oberst war doch bestimmt als Soldat so, naja, pflichtbewusst und zuverlässig?“
Pfarrer Vierneisel lachte laut heraus.
„Mein Junge, Oberst wurde er schon lange vor seiner Zeit beim Militär genannt. Er war halt schon immer ein schnittiger Kerl und hat gerne das Kommando geführt. Als ich die drei kennenlernte, da war da noch nichts mit zuverlässig, das kam erst später.
Dein Großvater und seine zwei Freunde haben mit ihren Flugzeugen so ziemlich alles angestellt, wovon man besser die Finger lassen sollte.“
Paul zog die Augenbrauen nach oben.
„Nicht, dass du etwas Falsches von deinem Großvater denkst“, beeilte sich Pfarrer Vierneisel zu ergänzen.
„Er war ein guter Mann. Die drei haben nur mit ihren Flugzeugen Sachen über das Gebirge geschafft, für die sie ganz schönen Ärger bekommen hätten, wenn sie den Gendarmen in die Finger gefallen wären.“
„Dann waren Opa und seine Freunde also Schmuggler?“
„Schmuggler? Ach weißt du, es waren eben drei junge Männer, die nach ihren eigenen Regeln lebten. Aber sie haben nichts herüber gebracht, womit ich nicht einverstanden gewesen wäre. Du darfst mir eines glauben mein Junge, die Kirche hier zum Beispiel würde nicht so aussehen, wenn es diese drei nicht gegeben hätte. Und ich habe ihnen geholfen.
Wenn zum Beispiel Nebel oder schlechtes Wetter war, habe ich die Glocken geläutet, damit sie ihre Landebahn finden konnten. Du musst dir das so vorstellen, Paul. Es gab durch das Gebirge nur zwei Möglichkeiten, wie man unterhalb der Gipfel und somit vor neugierigen Blicken geschützt fliegen konnte.
Einmal die Passstraße entlang, die hatte natürlich den Nachteil, dass man von einem Fuhrkarren oder von den Berittenen entdeckt werden konnte. Damals wurde schnell geschossen, auch auf Flieger.“
Paul vergaß zu trinken.
„Aber dann gab es auch noch die Bärenpassage, gefährlich und extrem schwer zu fliegen, nichts für Angsthasen.
Und die drei waren auf der Bärenpassage zuhause. Ich glaube, dein Großvater hätte sie auch mit verbundenen Augen fliegen können. Und wahrscheinlich hat er es auch gemacht. Na, lassen wir das.“ Der Pfarrer nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas. Paul hörte weiter still zu.
„Irgendwann war das wilde und ungebundene Leben vorbei, und ihr Land hat sie gerufen. Dein Großvater und der Oberst gingen in die Armee, Doktor Capello aber wollte so weitermachen wie bisher. Es war ja auch eine lustige Zeit und mit diesen gefährlichen Kurierflügen konnte man auch einen hübschen Gewinn machen. Aber es war sehr riskant, alleine zu fliegen.
Kurz nach der Trennung der Gruppe war Doktor Capello bei sehr schlechtem Wetter gegen den Rat seiner Leute gestartet, kam aber nie auf unserer Seite des Gebirges an. Drei Tage lang habe ich die Glocken geläutet, aber ohne Erfolg. Der Eindecker, das Markenzeichen vom Doktor, zog nie mehr über unseren Himmel. Wahrscheinlich liegt das Wrack in einer der vielen unzugänglichen Schluchten.
Der Oberst und dein Großvater haben sich den Tod von Doktor Capello sehr zu Herzen genommen.
Ich glaube, ihre Schuldgefühle, weil sie ihn alleine gelassen hatten, waren der Grund, warum sie sich später fast nicht mehr getroffen haben.
Der Oberst hat Karriere bei der Armee gemacht und wurde tatsächlich ein richtiger Oberst. Dein Großvater hat nach dem Krieg die Armee wieder verlassen, zu viele Regeln, sagte er. Ja, so waren diese drei. Das waren außerordentlich gute Flieger. Das wusste ich von Anfang an. Einen guten Flieger erkenne ich sofort am Blick.“
Pfarrer Vierneisel schaute Paul einen Moment zu lange an.
Paul wich dem Blick des Pfarrers aus und stellte sein leeres Limonadenglas auf den Tisch.
„Was hat denn der Bärenkopf auf den Flugzeugen bedeutet?“
Pfarrer Vierneisel schlug sich mit den Händen auf die Oberschenkel.
„Das erzähle ich dir auf dem Weg zur Kirche. Die Karten müssen noch auf die Empore.“
Es war allseits bekannt, dass der gute alte Pfarrer nach einem anstrengenden Wochenende montags gerne etwas länger im Bett blieb. Wenn dann in aller Frühe ein Lehrer die Karten für den Unterricht abholen wollte, dann schlief Pfarrer Vierneisel meistens noch. Mit der Schule hatte er deshalb die Vereinbarung, dass die Karten in der Kirche oben auf der Empore lagen und dort abgeholt werden konnten.
„Bist du so lieb, Paul, und trägst mir die Karten in die Kirche? Ich fühle mich noch immer etwas unpässlich.“
Paul stemmte sich den Packen auf den Rücken und der Pfarrer klopfte gegen den harten Lederumschlag: „Ein paar von den älteren Karten sind übrigens von deinem Großvater.
Nachdem sich die Gruppe aufgelöst hatte, spendete er einen Teil seiner Habseligkeiten der Gemeinde. Also trag die Karten mit Ehrfurcht.“
Paul und der Pfarrer verließen das Pfarrhaus und überquerten den Kirchplatz. Pfarrer Vierneisel verschränkte wieder die Hände auf dem Rücken.
„Also der Bärenkopf. Ja nun, das war ja nicht alles so ganz sauber, was die drei da mit ihren Flugzeugen machten.
Und öfters als einmal wurden sie von den Gendarmen gejagt, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite der Berge. Wenn sie sich also mal wieder für ein paar Tage verstecken mussten, dann machten sie das in einer entlegenen Hütte in den Bergen. Zu essen gab es da natürlich nicht viel, nur die Fische, die sie aus einem nahe gelegenen Fluss fangen konnten. Allerdings gab es da auch Bären.“
Pfarrer Vierneisel nickte Paul zu, den Seiteneingang der Kirche zu nehmen. „Ich will nicht, dass mich vielleicht noch die Alten in der Kirche so sehen. Wo war ich? Ach ja, die Bären. Die haben sich natürlich auch die Fische aus dem Bach gefangen und niemand durfte in ihre Nähe kommen. Gefährliche Biester, sag ich dir.“
Pfarrer Vierneisel öffnete den Seiteneingang der Kirche einen Spalt weit, lugte hinein und grinste Paul dann an. „Deshalb sind immer zwei von den Männern in den Flugzeugen über den Fluss geflogen und haben die Bären verscheucht, der Dritte war am Fluss und hat den Fisch gefangen. Das muss da ganz schön wild zugegangen sein, die Piloten flogen knapp über dem Boden mit Überschlägen, um die Bären von dem Mann am Fluss weg zu halten.
Bärentanz haben sie dieses Spektakel genannt.“
Pfarrer Vierneisel schob Paul mit den Karten durch die Tür ins Seitenschiff der Kirche. Im Hauptraum vor dem Altar saßen ein paar alte Frauen, ins Gebet versunken. An der Wand entlang, vor möglichen neugierigen Blicken geschützt, huschte Pfarrer Vierneisel zur Empore. Der Begriff Empore war fast ein wenig schmeichelhaft für den kleinen Überbau der Beichtstühle, die an der Wand des Seitenschiffes standen.
Von Kirchgängern wurde die Empore nicht genutzt, vielmehr verstaute der Pfarrer hier entgegen den brandschutzrechtlichen Verordnungen die Fahnen für die Prozession.
Hier musste also jeden Montagmorgen ein Lehrer die Karten holen.
Am Fuß der engen Wendeltreppe, die auf die Empore führte, erzählte Pfarrer Vierneisel weiter: „Als einmal dein Großvater den Fisch fangen sollte, während die beiden anderen die Bären vertrieben, ist etwas Seltsames passiert.
Die Alttiere waren alle vor den Flugzeugen geflüchtet und hatten deshalb auch keinen Fisch, als ein noch ganz junger Bär den Tieffliegern zum Trotz auf deinen Großvater zu gewatschelt kam. Kerzengerade hoch in die Luft schossen der Oberst und Doktor Capello mit ihren Flugzeugen und stürzten sich wieder auf den kleinen Bären. Aber der ließ sich nicht einschüchtern. Vor deinem Großvater hat er sich aufgestellt, auch wenn er noch so klein war, dass er ihm nur bis zur Hüfte ging. Dein Großvater war am Anfang erschrocken, aber dann hat ihn der Mut des kleinen Bären beeindruckt, und er hat ihm ein paar Fische aus seinem Eimer an das Ufer gelegt.“
Pfarrer Vierneisel nahm Paul die Karten ab und keuchte die Wendeltreppe hoch. Oben auf der Empore verstaute er die Karten zwischen den Fahnen und sprach, so wie er es als Pfarrer am liebsten tat, zu dem unten stehenden Paul: „In dieser Geschichte hat sich alles das abgespielt, was den drei jungen Piloten wichtig war: der Mut des Bärenjungen, sich einer gefährlichen Situation zu stellen und unbeirrt zu sagen, ich will. Das Können der beiden Piloten in der Luft, und die Mildtätigkeit deines Großvaters.
Deshalb haben die drei den Bären zu ihrem Wappen gewählt. So“, Pfarrer Vierneisel ging wieder zur Wendeltreppe.
„Wenn du jetzt bitte noch“, Holz splitterte, krachte, knallte, ein Schrei, Rumpeln, Knallen, kurz nach oben geworfene Hände, Scheppern aus dem mittleren Beichtstuhl, Staub aus allen Ritzen, der Pfarrer weg.
Paul wusste erst einmal nicht, was er eben gesehen hatte. Und wenn er es gewusst hätte, dann wäre er nicht sicher gewesen, ob er es glauben sollte.
Von einem der seitlichen Beichtstühle flog die Tür auf, eine alte Frau sprang geduckt heraus „Jesusmariandjosef!“ und rannte zu den anderen Frauen im Hauptschiff.
„Der Leibhaftige! Der Leibhaftige ist in die Beichte gefahren!“
Paul eilte zur Tür des mittleren Beichtstuhls und riss sie auf. Von dem ehemals roten Samtbezug war nichts mehr zu sehen. Fast der ganze Beichtstuhl war voll zersplitterter Holzplanken und Lehmbrocken.
An einer abgebrochenen Latte an der Decke hing ein langer Fetzen des Umhangs von Pfarrer Vierneisel.
„Um Himmels willen!“ Vom Haupteingang der Kirche schrie die dicke Haushälterin.
„Herr Pfarrer!“ Sie rannte, was sie konnte zum eingestürzten Beichtstuhl, ihren gewaltigen Körper beim Laufen immer nach links und rechts schwingend.
„Weg da!“ Sie schob Paul zur Seite und begann, den Schutt aus dem Beichtstuhl zu schaffen, bis der blutige Kopf und der Oberkörper des bewusstlosen Pfarrers freilagen.
„Hochwürden, wachen Sie doch auf!“ Auf dem Schutthaufen kniend fing die Haushälterin an, den Pfarrer zu ohrfeigen, damit er wieder zu sich kommt. Links, rechts, links, rechts, vielleicht ein wenig fester, als es für die Erste Hilfe notwendig gewesen wäre. Die Ohrfeigen nutzten nichts, die robuste Dame ging dazu über, den armen Pfarrer mit Faustschlägen zu bearbeiten. Links, rechts, links, rechts, dass es nur so staubte.
„Ahhhh, nicht totschlagen.“ Die Stimme von Pfarrer Vierneisel klang noch schwach, die dicke Mamsell schlug noch zweimal sicherheitshalber zu, dann schaffte sie weiter Holzlatten und Lehmbrocken vom geschundenen Geistlichen. Mittlerweile hatten sich auch die alten Frauen aus dem Hauptschiff neugierig um den Beichtstuhl versammelt.
„Also wirklich, Herr Pfarrer“, schimpfte die Mamsell, immer noch den schweren Schutt zur Seite werfend.
„Was sollen nur die Leute denken. Stürzen sie während des Rosenkranzes in den Beichtstuhl!“
Pfarrer Vierneisel war noch nicht ganz freigelegt und röchelte leise vor sich hin.
„Wenn ich nicht ständig auf sie aufpasse, Herr Pfarrer. Sie machen aber auch Sachen. Das ganze Dorf wird sich wieder den Mund zerreden über diese Geschichte. Also wirklich.“
Pfarrer Vierneisel schlug die Augen auf.
„Das ganze Dorf?“
Er schaute zu Paul und hauchte: „das ganze Dorf!“
Dann blickte er mit einem seligen Lächeln nach oben.
„Dem Himmel sei Dank.“
Nur für Jungs
Eine lang gezogene Staubwolke wirbelte über das Feld, der Doppeldecker raste auf die dürren Hecken zu, Paul setzte sich die Fliegerbrille zurecht und zog den Bug nach oben.
Er musste schon den Kopf schütteln über das, was er eben beim Pfarrer Vierneisel erlebt hatte. Nur schade, dass er mit niemandem darüber reden konnte. Nicht mit seinen Eltern, die ihm die Fliegerei sicher verboten hätten und nicht mit Gülcan, die ihm wohl kein Wort davon geglaubt hätte. So wie Paul ihr die Geschichten mit ihrem U-Boot auch nicht glaubte, obwohl er sie immer sehr spannend fand.
Das Flugzeug stieg weiter nach oben und Paul wurde angenehm in seinen Sitz gedrückt. Jetzt bog er in eine sanfte Linkskurve und flog noch einmal einen Bogen über das kleine Dorf, wo jetzt ganz sicher die Geschichte vom Pfarrer und dem eingestürzten Beichtstuhl die Runde machte. Paul stellte sich vor, wie sich selbst der störrische Bauer Zinsmeier den Bauch vor Lachen hielt und nicht im Entferntesten auf die Idee kam, dass der Pfarrer einen Teil seiner Verletzungen von einem nächtlichen Besuch in der Schnapsbrennerei davon getragen hatte.
Paul umkreiste den Kirchturm und brachte sein Flugzeug dann auf den Kurs für den Nachhauseweg, unter ihm lagen die Dorfmauer und der Pfarrgarten.
Zum Glück blieb dem Pfarrer Vierneisel jetzt der Sturz vom Obstbaum erspart.
Bald hatte Paul seine Flughöhe erreicht. An einem derart heißen Samstag war die Welt unter ihm wie ausgestorben.
Da machte es Spaß, nicht ganz so hoch wie sonst zu fliegen. Die wenigen Radfahrer und der ein oder andere Bauer nahmen sich in dieser Ruhe nämlich die Zeit, zu dem alten Doppeldecker hinauf zu schauen und zu winken. Und Paul wippte als Antwort mit den Tragflächen. Er schmunzelte – sicher ahnte niemand auf dem Boden, dass hier oben der ungewöhnlichste Pilot der Welt seine Runden drehte.
Paul blickte zufrieden auf die goldene Taschenuhr am Cockpit, er lag gut in der Zeit, seine Eltern waren sicher noch beim Einkaufen. Das sollte heißen, seine Mutter war beim Einkaufen, sein Vater trug wie immer stöhnend die Taschen hinter ihr her.
Paul konnte sich über einen rundum gelungenen Kurierflug freuen. Nicht nur, dass er die Karten abgeliefert hatte und dem armen Pfarrer Vierneisel ein Sturz vom Obstbaum erspart blieb, Paul wusste jetzt auch, was der Spruch auf dem Innendeckel seiner Uhr bedeutete. Und wenn Paul noch ein paar weitere Streiche bei Frau Schmal-Wimmer aushecken würde und als Strafarbeit wieder die Karten zum Pfarrer bringen musste, dann könnte er auch bestimmt in Erfahrung bringen, was die drei seltsamen Symbole zu bedeuten hatten, die oberhalb des Spruches eingraviert waren. Ein Kreis mit zwei Strichen, ein dickes Kreuz und drei parallele Striche.
Der Sommerwind wirbelte um Pauls Nase, bei jedem Rütteln und Absenken des Doppeldeckers pendelte die Taschenuhr hin und her.
Außer dem Flugzeug war die Uhr das Wertvollste, was Paul besaß.
Er konnte sich noch gut daran erinnern, als er sie von seinem Großvater geschenkt bekam.
Es war nach ihrem letzten gemeinsamen Flug, und der alte Mann war damals schon sehr müde.
Nach der Landung half er nicht wie sonst dabei, den Doppeldecker in die Scheune zu schieben, sondern setzte sich schwer atmend auf einen Baumstumpf am Rande der großen Wiese. Als Paul nach dem Rechten sehen wollte, zog ihn Opa zu sich her, drückte ihm die Uhr in die Faust und umschloss sie mit beiden Händen. Dabei nickte er Paul mit zusammengekniffenen Lippen zu.
Paul konnte nichts sagen, er wusste genau, was dies zu bedeuten hatte.
Mit Tränen in den Augen starrte er seinen Großvater an, bis dieser aufstand und fluchend seine Fliegerhaube in den Staub warf: „Jetzt behandelst du mich auch schon so mitleidig, dabei reicht es vollkommen, wenn deine Eltern so tun, als wäre ich aus Porzellan.“
Dann stemmte Opa die Hände in die Hüften und atmete ein paar Mal tief ein und aus. Er ging zu Paul zurück und strich ihm über den Kopf.
„Weißt du Paul, das mit dem Sterben ist doch eigentlich so, wie mit dem Hintern abwischen. Jeder macht es, aber keiner spricht darüber.
Und wenn man mal einen dabei ertappt, dann ist es gleich pfui und furchtbar peinlich. Aber glaub mir, es ist vollkommen in Ordnung und ihr müsst mich nicht immer so anschauen, als hätte ich viereckige Ohren.“
Und dann lachte Opa und boxte Paul leicht auf die Brust: „Also das Sterben, das kann ja so schwer nicht sein.
Das haben schon so viele gemacht, und ich hab noch von keinem gehört, der sich danach beschwert hat. Wichtig ist doch nur, dass du vorher eine Menge großer Aufgaben erledigen konntest und nicht gekniffen hast, wenn es Abenteuer zu bestehen galt.
Eben wie beim Hintern abwischen. Wenn du nur einen ordentlich großen Haufen gemacht hast, dann kann es dir egal sein, ob dir die Leute beim Abwischen zusehen. Denn das müssen sie dir erstmal nachmachen, bevor sie mit Tuscheln anfangen.“
Opa legte seinen Arm um Pauls Schultern und zwinkerte ihm zu: „Also ich habe ja in meinem Leben eine ganze Menge großer Haufen gemacht, ich meine Abenteuer bestanden. Habe ich dir zum Beispiel schon erzählt, wie ich im Krieg ganz alleine das Schwarze Bataillon besiegte?“ Paul wischte sich die letzte Träne aus dem Auge und blickte seinen Opa erwartungsvoll an.
„Also, das schwarze Bataillon war die am meisten gefürchtete Fliegerstaffel der gegnerischen Armee. Nur die besten Piloten flogen dort und das Bataillon war berüchtigt dafür, dass es selbst zahlenmäßig weit überlegene Feinde besiegen konnte. Dummerweise waren wir nicht in der Überzahl – genau genommen war ich der einzige Pilot weit und breit und es war klar, dass das schwarze Bataillon mit mir kurzen Prozess machen würde. Aber kneifen konnte ich nicht.
Unsere Soldaten am Boden erwarteten für den nächsten Morgen einen Angriff und die Flugzeuge in der Luft sollten ihre Leute am Boden schützen.
Es wäre grauenvoll gewesen, wenn meine Kameraden sowohl am Boden als auch aus der Luft angegriffen worden wären, ohne dass ich ihnen mit meinem Flugzeug beigestanden hätte. Deshalb bin ich in der Nacht vor dem großen Kampf in das feindliche Lager geschlichen.
Jetzt denkst du bestimmt, was für ein Unsinn. Stehlen hätte ich die Flugzeuge alleine nicht können, und wenn ich an den Flugzeugen etwas zerstört hätte, dann wäre das eben morgens wieder repariert worden. Aber ich hatte einen Plan.
Ich habe an jedem Flugzeug vorne am Maschinengewehr die Patronen herausgenommen und dafür Maiskörner in die Munitionskiste gesteckt. Dann habe ich mich wieder aus dem feindlichen Lager an den Wachen vorbei hinausgeschlichen.
Am nächsten Morgen begann der Kampf.“
Paul rutschte näher zu seinem Großvater, der nun mit leiser Stimme weiter sprach, aber mit seinen gewaltigen Händen unsichtbare Linien in die Luft zeichnete.
„Bei Sonnenaufgang stieg ich auf und drehte meine Kreise. Ich konnte sehen, wie sich die beiden Armeen am Boden immer näher aufeinander zu bewegten, aber vom schwarzen Bataillon war weit und breit nichts zu sehen. Hatten sie meinen nächtlichen Besuch entdeckt und schnell die Munitionskisten wieder aufgefüllt?
Plötzlich spürte ich, wie sich etwas mit der Luft um mein Flugzeug herum veränderte. Ich kann es nur schwer beschreiben, aber es war fast, als wäre gleich der Siedepunkt erreicht, jeden Moment müsste die Luft zu brennen anfangen. Und dann sah ich sie.
Aus der aufgehenden Sonne heraus stürzten sie sich auf mich, dreißig Flugzeuge oder mehr, schwarz mit den an den Seiten aufgemalten Drachenköpfen.
Ich riss mein Flugzeug herum und schraubte mich kerzengerade nach oben, bis der Motor das Gewicht der Maschine nicht mehr tragen konnte und ich seitwärts wegkippte. Schau mal, so ungefähr.
Ich konnte selbst nicht vorhersagen, in welche Richtung ich fiel, noch weniger konnten es also meine Verfolger ahnen, das gab mir einen kleinen Vorsprung. Ich flog eine scharfe Wende und steuerte geradewegs auf die Angreifer zu, die sich in ihrer berüchtigten Y-Formation auf mich stürzten. Da hörte ich vom vordersten Flugzeug den ersten Schuss – Plob. Habe ich eben Schuss gesagt? Nun Paul, du weißt es besser. Die Hitze der Motoren hatte den Mais zum Aufplatzen gebracht. Plob Plob, auch von den anderen Flugzeugen knallte es nun lustig zu mir herüber. Ich stieß durch die Formation und drehte eine weitere Schraube. Im Vorüberfliegen sah ich die gegnerischen Piloten, wie sie wütend auf ihre Bordwaffen einschlugen, aber es nutzte nichts. Unmengen von Popcorn flogen aus den Maschinen. Bald standen die Soldaten am Boden in einem wahren Regen aus leckeren weißen Flocken. Da hatte natürlich keiner mehr Lust zu kämpfen – alle ließen sie ihre Waffen fallen und rannten mit weit geöffneten Mündern durch den weißen Zauber.
Die Versuche der Jäger des schwarzen Bataillons, doch noch eine halbwegs anständige Luftschlacht zu bieten, wurden immer verzweifelter und sorgten nur dafür, dass jeder Meter am Boden mit Popcorn bedeckt wurde. Und dazwischen flog ich meine Kapriolen und reizte die Piloten des schwarzen Bataillons immer mehr, bis sie zerknirscht abzogen. Die Schlacht hat an diesem Tag natürlich niemand gewonnen, dafür aber haben die Soldaten das beste Popcorn ihres Lebens gegessen. Und das mein lieber Paul, ist doch das Allerwichtigste. Würdest du nicht auch ein leckeres Popcorn einem sinnlosen Krieg vorziehen, bei dem es den Leuten nur schlecht geht? Siehst du.
Und wenn ich alleine das schwarze Bataillon besiegen kann, werde ich das, was jetzt vor mir liegt, doch auch noch schaffen, oder?“
Der Motor des alten Doppeldeckers lief unruhig. Seit er Paul das letzte Mal beinahe um die Ohren geflogen wäre, gab es Probleme mit der Feinabstimmung. Ein paar Ersatzteile mussten ausgetauscht werden, und weil ein zehnjähriger Junge nicht so ohne Weiteres an Teile für einen 90 Jahre alten Doppeldecker kam, musste sich Paul mit ausrangierten Stücken aus alten Mofas behelfen. Auch der Rasenmäher der Familie lieferte immer wieder dringend benötigte Ersatzteile, Papa wunderte sich nur, warum er regelmäßig im Garten in einer stinkenden Wolke aus schwarzem Rauch stand. Aber Papa konnte natürlich problemlos den Rasenmäher zum Reparieren geben, das war Paul mit dem Doppeldecker nicht möglich.
Dass der 130 PS starke Umlaufmotor mittlerweile fast zur Hälfte aus Mofa- und Rasenmäherteilen bestand, hörte man beim Fliegen. Paul hatte es bis jetzt noch nicht geschafft, die 9 Zylinder sauber aufeinander abzustimmen.
Wenn man als Zehnjähriger ein Flugzeug besaß, dann hatte man eben immer etwas zu tun – umso mehr, wenn es sich dabei um ein gebrauchtes Modell handelte.
Hier oben in der Luft konnte Paul allerdings nicht viel ausrichten. Er überprüfte kurz Geschwindigkeit und Drehzahl, änderte dann die Gemischeinstellung und schon arbeitete der Motor wieder regelmäßiger.
Sein Großvater hatte den Doppeldecker über die Jahrzehnte am Laufen gehalten, da würde es Paul wohl auch schaffen.
Ja, sein Großvater.
Paul vergaß kurz den herrlichen Samstagnachmittag und verlor sich wieder in seinen Gedanken.
Der Tag, an dem er das Flugzeug übernommen hatte, war der traurigste Tag seines Lebens.
Es war kurz nachdem Paul die goldene Taschenuhr geschenkt bekam.
An einem schönen Sonntagmorgen setzte sich sein Großvater, als noch alle schliefen, mit seiner Fliegerhaube und der achteckigen Pilotenbrille auf dem Kopf ins Wohnzimmer, hielt den Schlüssel für seinen geliebten Doppeldecker in der Hand und blickte aus der offenen Balkontür über die Wiesen und Felder in die aufgehende Sonne.
Als Paul an diesem Morgen mit seinen Eltern zum Frühstück herunter kam und Opa noch immer auf seinem Lieblingssessel im Wohnzimmer saß, bemerkte Paul, dass der Schlüssel auf dem Boden lag.
Er konnte ihn gerade noch unbemerkt aufheben, bevor Mutter in der Türe erschien, die Hände vors Gesicht warf und Paul dann schnell auf den Gang zog, während sein Vater kopfschüttelnd um den Sessel ging und vor Großvater auf die Knie sank.
Seitdem flog Paul alleine. Er schob sich die Fliegerbrille nach oben und wischte sich mit dem Ärmel der Lederjacke über die Augen. Immer wieder gab es bei seinen Flügen besonders gefährliche, aber auch besonders schöne Momente, die er gerne mit jemandem geteilt hätte – mit seinem Großvater, aber auch mit Papa.
Aber Pauls Vater lebte in einer ganz anderen Welt als Opa und Paul.
Nicht das Abenteuer, sondern die Sicherheit war für Papa das Allerwichtigste.
Papa fuhr noch nicht einmal kurz zum Supermarkt, ohne am Auto das Reserverad und den Verbandskasten zu überprüfen. Deshalb fuhr Mama selbst für größere Einkäufe lieber mit dem Rad.
Alle großen Unglücke, so war Papas Meinung, hatten in ihrer Vorgeschichte einen Moment, an dem sie durch einen kleinen Handgriff hätten verhindert werden können. Nach dem Unglück musste man viel Zeit und Kraft aufwenden, um wieder mit dem Schaden fertig zu werden. Diese Mühe stand nach Meinung von Pauls Vater in keinem Verhältnis zu der Einfachheit des Momentes davor, an dem noch alles hätte gut werden können.
Papas große Leidenschaft galt nun diesem Moment, an dem man mit geringstem Aufwand eine große Tragödie vermeiden konnte.
Natürlich war es für Mama und Paul furchtbar peinlich, wenn sie mit dem Auto unterwegs waren. Die Straße vor ihnen war herrlich frei, hinter ihnen jedoch drängelte sich oft eine kilometerlange Schlange von Autos, Lastwagen und Traktoren, wütende Fahrer schimpften und machten Drohgebärden durch ihre heruntergelassenen Fenster. Aber Papa wollte einfach nicht den Moment verpassen, an dem er durch seine vorsichtige Fahrweise einen Unfall vermeiden konnte.
Auch mit den wilden Geschichten, die Großvater immer erzählte, konnte Papa nichts anfangen. Er schaute immer ganz säuerlich, wenn Opa und Paul die Köpfe zusammensteckten und vor sich hin kicherten.
„Du bist genauso wie dein Großvater“, sagte Papa manchmal in ärgerlichem Ton zu Paul und glaubte, dass dieser Vergleich eine besonders harte Strafe sein müsste.
Aber Paul bekam bei dem Gedanken, wie sein Opa zu sein, immer ein ganz warmes Gefühl ums Herz.
Paul erkannte weit vor sich das kleine Städtchen, an dessen Rand das alte Anwesen seiner Familie mit der Scheune und der behelfsmäßigen Landebahn lag. Bald konnte sich Paul auf den Landeanflug vorbereiten.
Während er die Geschwindigkeit drosselte und in eine lang gezogene Schleife einschwenkte, spürte Paul die Freude auf seine Eltern. Dabei ging ihm der Gedanke durch den Kopf, er würde vielleicht nur deshalb wegfliegen, um wieder nach Hause zu kommen.
Langsam näherte sich das Flugzeug der kurz gemähten Wiese, Paul brachte den Gashebel in die Leerlaufstellung und setzte sachte mit den Rädern auf, die nun wieder ohrenbetäubend quietschten.
Paul wollte gerade den Motor abschalten, während er noch auf das hintere Scheunentor zurollte, da sah er eine Gestalt, die sich von den Obstbäumen löste und auf ihn zu gerannt kam.
Sein Vater hatte ein wutverzerrtes Gesicht und ballte die Fäuste. Mit nur wenigen Sätzen hatte er das Flugzeug erreicht, sprang auf die untere Tragfläche und fuchtelte hektisch im Cockpit herum.
„Du gibst mir sofort den Schlüssel und kommst heraus! Den Schlüssel! Und raus hier!“
Paul konnte sich kaum mehr bewegen, sein Vater lag halb über ihm, suchte nach dem Schlüssel und wollte gleichzeitig seinen Sohn aus dem Flugzeug zerren.
In diesem Getümmel stieß wohl Pauls Vater den Gashebel nach vorne und der Doppeldecker nahm wieder Fahrt auf.
Schneller, immer schneller raste er auf die Scheune zu.
Der schimpfende Vater, die quietschenden Räder, der hochdrehende Motor – Paul dachte bereits in dem Moment, als sein Vater zwischen den Bäumen hervorgesprungen war, dass es wohl nicht mehr schlimmer kommen konnte.
Aber jetzt jagten sie in dem alten Doppeldecker auf die Scheune zu.
Schon war der Punkt überschritten, an dem man die Maschine noch hätte abbremsen können.
Immer stärker zerrte der Vater an Paul. Immer verzweifelter suchte er nach dem Zündschlüssel und sah nicht, dass die Scheune schon das ganze Blickfeld vor dem Flugzeug eingenommen hatte.
Die Maschine wurde nochmals schneller, gleich musste sie mitsamt Vater und Sohn in die Scheune einschlagen, niemand konnte den furchtbaren Zusammenstoß jetzt noch verhindern – außer natürlich dem ungewöhnlichsten Piloten der Welt.
Paul drückte sich nach hinten in seinen Sitz, weg vom tobenden Vater, und zog den Steuerknüppel mit einem lang gezogenen Schrei fest an sich heran.
Im Abheben riss er das Flugzeug in eine steile Linkskurve. Das rechte Rad durchschlug eine überstehende Dachlatte, morsches Holz flog splitternd durch die Luft, ein kurzes Wackeln, dann hatte Paul wieder die Kontrolle über sein Flugzeug, das er im leichten Steigflug ausbalancierte.
Jetzt konnte er aufhören zu schreien und sich stattdessen umschauen.
Sein Vater war durch die Wucht des ruppigen Startmanövers zur Seite geworfen worden.
Er hielt sich nun an den Verbindungsstreben zwischen oberer und unterer Tragfläche fest, während er versuchte, langsam wieder auf die Beine zu kommen.
Paul hatte mittlerweile wieder genügend an Höhe gewonnen, um gefahrlos – vor allem für seinen Vater dort draußen auf der Tragfläche – eine Schleife zu drehen und vorsichtig wieder zur Landung anzusetzen.
Paul wusste, dass dies sein letzter Landeanflug sein würde und er wollte ihn so schnell wie möglich hinter sich bringen. Da hörte er durch das Pfeifen des Windes von den Flügelspitzen her ein Geräusch, das er hier oben wohl am allerwenigsten erwartet hätte: „Juchei! Juhuhuchei!“ schrie sein Vater hoch über den Dächern ihres Städtchens. „Hahaha, haha!“
Pauls Vater stand nun aufrecht zwischen den Tragflächen, hielt sich an den Verstrebungen fest und reckte die Nase in den Wind.
Statt einer Kurve flog Paul jetzt eine Acht, immer noch mit dem johlenden Vater auf der Tragfläche.
Platzrunde und Kehre zur Landebahn.
Pauls Vater hielt sich jetzt nur noch mit einer Hand fest, die andere Hand wie einen Rammbock vor sich in die Luft gestreckt, die Krawatte wirbelte ihm links und rechts am Hals vorbei. „Ja! Ja! Ja!“
Paul setzte die Maschine wieder vorsichtig auf und rollte aus, sein Vater sprang von der Tragfläche und ließ sich über die Wiese purzeln.
Alle viere von sich gestreckt blieb er lachend auf dem Rücken liegen.
Nachdem Paul den Motor abgestellt hatte, lief er zu seinem Vater, gab ihm die Hand und half ihm beim Aufstehen.
Ihm war klar, dass er sich jetzt von seiner Fliegerei verabschieden musste.
Sein Vater wischte sich keuchend die Augen aus, dann betrachtete er lange den Doppeldecker.
„Das ist also das Flugzeug von Opa. Hätte nie gedacht, dass es das wirklich noch gibt. Und du hast es von Opa bekommen? Unglaublich.“
Er ging um den Doppeldecker herum und blieb kurz vor dem aufgemalten Bärenkopf stehen.
„Brauche wohl nicht zu fragen, wer dir das Fliegen beigebracht hat. Wahnsinn. Bist offensichtlich recht geschickt.“
Paul blickte auf den Boden.
„Geht so.“
„Und das Flugzeug, ist es denn in technisch einwandfreiem Zustand?“
„Na ja.“ Paul zuckte kurz mit den Schultern, was sollte er schon sagen. Es war eben alt.
Sein Vater schüttelte nur den Kopf. Er stand neben dem Heckflügel und starrte mit zusammengekniffenen Augenbrauen vor sich hin.
Paul wusste, was er nun tun musste.
Er ging zu seinem Vater und hielt ihm den Schlüssel für das Flugzeug hin.
Das war es dann.
Jetzt konnte er nicht mehr in den Himmel aufsteigen, um Opa nahe zu sein. Pauls Vater blickte den Schlüssel eine ganze Weile an.
„Was habe ich nur falsch gemacht?“
Paul streckte ihm noch immer den Schlüssel wortlos entgegen, sein Vater blickte ihn an, als würde ihm eine übergroße, behaarte Spinne entgegengehalten.
„Ich kann dir unmöglich erlauben, weiter zu fliegen. Das ist dir hoffentlich klar. Aber ich kann mich auch nicht einfach in einen Handel einmischen, den mein Vater mit meinem Sohn abgeschlossen hat. Es gab früher einmal einen Handel zwischen deinem Großvater und mir, in den hatte sich auch jemand eingemischt. Das hat mir damals das Herz gebrochen.
Verzwickte Sache. Was hätte wohl dein Großvater an meiner Stelle gemacht, ich meine, wenn er noch nie so ein Ding geflogen wäre und nun entscheiden müsste, ob sein Sohn sich damit in Gefahr begeben soll?“
Paul musste nicht lange überlegen, er hatte ganz deutlich das Bild seines Opas vor sich: „Opa hat immer gesagt, wenn er einen Fehler macht, dann lieber, weil er etwas getan hat und nicht, weil er etwas versäumt hat. Wenn er etwas falsch gemacht hat, dann war das eben so und er konnte es das nächste Mal besser machen. Damit war die Sache für ihn dann erledigt. Wenn er etwas versäumt hat, meinte er, dann würde es ihn sein Leben lang verfolgen.“
Pauls Vater kratzte sich am Kinn.
„Das hilft mir jetzt auch nicht weiter, schließlich geht es hier ja um dich. Da nehme ich nicht so einfach Fehler in Kauf. Ich weiß genau, jetzt ist der Moment, an dem ich vielleicht eine Katastrophe ganz leicht verhindern könnte.“
„Du könntest mit mir fliegen. Schauen, ob alles in Ordnung ist.“
„Mit dir fliegen?“
Pauls Vater legte die Stirn in Falten.
„Du meinst, ich soll mit dir fliegen, so richtig? Im Flugzeug sitzen und nicht auf der Tragfläche?“
Beim Gedanken an die letzten Minuten bekam Pauls Vater ein seltsames Kribbeln im Bauch.
„Noch einmal fliegen?“
Er ließ Paul stehen, lief ein paar Meter auf die behelfsmäßige Start- und Landebahn und blickte in den Himmel. Nach ein paar Minuten ging ihm Paul nach, schob seine Hand in die von Papa und beide standen nebeneinander, den Blick in die Ferne gerichtet.
Der Schrei eines Bussards riss Pauls Vater aus seinen Gedanken, er ging in die Hocke und blickte Paul in die Augen: „Es ist doch so, seit ewigen Zeiten hat es etwas gegeben, das von den Vätern an die Söhne gegeben wurde und die haben es dann an ihre Söhne weitergegeben. Das war etwas ganz Besonderes, das hatten dann nur die Väter und die Söhne gemeinsam. Und ich habe es wohl vermasselt. Mir hat dein Großvater nicht beigebracht, wie man fliegt.“
Papas Blick wechselte von Paul zum Schlüssel und wieder zurück.
„Ich glaube, ich habe einiges nachzuholen.“
Schließlich umschloss er mit seinen Händen Pauls Faust, die den Schlüssel hielt und sagte: „Lass mal gut sein, Paul. Ich glaube, das da eben sollte unter uns bleiben.“
Mit diesen Worten drückte er den Schlüssel an Pauls Brust, legte einen Arm um die Schulter seines Sohnes und ging mit ihm zum Haus.
Pauls Gefühle fuhren Achterbahn.
So viel ging ihm durch den Kopf, so vieles wollte er seinen Vater fragen, dass er am Ende nur etwas vollkommen Unwichtiges herausbrachte: „Ihr seid früh dran.“
„Ja, mit uns hast du jetzt wohl noch nicht gerechnet, was? Die Nachbarn hatten uns angerufen, als wir gerade beim Einkaufen waren. Sie haben geglaubt, dass ein paar Männer in unser Haus eingebrochen sind. Da mussten wir natürlich sofort zurückgefahren. War aber falscher Alarm. Klar, wer bricht schon mitten am Tag irgendwo ein?“
Paul blickte zu seinem Vater hoch: „Das mit dem gemeinsamen Flug, das ist versprochen, ja?“
Sein Vater schmunzelte: „Mit dir macht man was mit. Lass mir nur ein wenig Zeit, den Flug von eben zu verdauen. Das war ganz schön heftig.“
Sie gingen ins Haus.
Als sie im Flur in Hörweite von Mama standen, setzte Pauls Vater ein gespielt ernstes Gesicht auf und sagte zu Paul übertrieben laut: „Du bist genauso wie dein Großvater.“
Dann zwinkerte er Paul heimlich zu – wie Opa.
Erlebnisse eines Studenten in Berlin
In vielen Bereichen sind die Folgen der jahrzehntelangen Teilung noch spürbar: Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt, Rechtsextremismus ... Jeder einzelne Wohnsitz des Protagonisten, eines jungen Mannes, eines Studenten, macht ein Kapitel des Romans aus. Und immer wieder fällt der Name eines Stadtteils, des Stadtteils Marzahn, ein Ort, den er von Anfang an meiden wollte. Am Ende bleibt ihm allerdings gar nichts anderes übrig als unfreiwillig dorthin zu ziehen. Und obwohl er immer mit den Rechtsradikalen umzugehen wusste, passiert schließlich die Katastrophe ...

Dr. phil. Roland Scheller, Jahrgang 1966, studierte Anglistik und Kommunikationswissenschaften an der TU Berlin und war 1999/ 2000 Erasmus-/Sokratesstudent in Cardiff, Wales, ist Semiotiker und Doktor der Philosophie und arbeitete als Archivar am Universitäts-Klinikum Kiel, als Übersetzer und als Interviewer in der Markt- und Meinungsforschung (Emnid, Inra, Ipsos, Infratel, Infratest, Allensbach Institut).
Roland Scheller: Endstation Marzahn, 300 Seiten, Broschur, € 14,98 ISBN 978-3-86992-086-3
Titelbild zum Download (300 dpi)
Leseprobe:
INTRO
Nahe der City-West und in der Nähe der Technischen Universität befand sich ein Café, das recht klassisch eingerichtet war, in dem diverse Gemälde hingen. Doch nicht zuletzt durch die ockerfarbenen Wände wirkte es recht miefig. Es war vollgepfropft mit Tischen und Stühlen, sodass die Kellnerinnen beim Bedienen Schwierigkeiten hatten überhaupt durchzukommen, und die Gäste sich gegenseitig auf die Pelle rückten. Die Kundschaft kam überwiegend aus dem Studentenmilieu, auch Absolventen, die mal wieder die Studentenatmosphäre genießen wollten, aber auch Schüler, Künstler und ein paar wenige Dozenten waren darunter. Es gab Gelegenheitsbesucher und Stammgäste, die fast täglich dort herumlungerten. Die Kellnerinnen waren fast ausnahmslos Studentinnen, die sich mit dem Kellnern über Wasser hielten. Doch ihr Stundenlohn lag bei fünf Euro. Deshalb waren die Frauen auf Trinkgeld angewiesen. Die meisten von ihnen trugen während der Arbeit schwarze Oberteile, dazu lange Schürzen mit dem Namen des Cafés aufgedruckt. Das Café war recht dunkel, es gab darin nicht mehr als zwei Fenster und außerdem die gläserne Eingangstür. Das Herrenklo war ständig defekt. Niemand schickte sich an, es zu reparieren. Genauso wie an der nahen Universität wurden Beschwerden auch hier nicht weitergeleitet. Einer der Tresenmänner handelte mit Dope, es lagen verschiedene Tageszeitungen aus, die in eine extra Holzeinfassung eingespannt waren. Mal wurde Klassik gespielt, mal lief moderner Rock mit intelligenten Texten. Die Tresenmänner gaben sich sehr viel Mühe bei der Auswahl der Musik. Hier herrschte eine typische Caféhausatmosphäre mit Hintergrundmusik im mittleren Dezibelbereich und dem ständigen Getuschel der Gäste, dazu das Klirren von Gläsern, Geschirr und Besteck. Ab dem späten Nachmittag waren die Kellnerinnen meistens genervt. Um 17 Uhr war Schichtwechsel, auch am Wochenende. Um 18 Uhr kam Herr Madsen, um den Kassenstand zu überprüfen. Das geschah ganz diskret und ohne großes Aufsehen. Die Kellnerinnen machten keinen Hehl daraus, wenn sie einen Gast nicht mochten. Nur wenige von ihnen akzeptierten ausnahmslos jeden Gast. Einige Kellnerinnen jedoch legten ein sadistisches Verhalten gegenüber diversen Dauergästen an den Tag. Es waren zumeist die Singles, die regelmäßig allein an den Tischen saßen und obendrein versuchten, mit der jeweiligen Bedienung zu flirten. Das passte jedoch nicht in die hektischen Arbeitsschichten dieser weiblichen Teilzeitkräfte. Und sie machten eiskalt deutlich, dass sie sich mit den Gästen nicht unterhalten wollten, sondern diese komplikationslos bedienen. Doch auch ohne Schwierigkeiten verursacht durch die Gäste legten die kellnernden Studentinnen ständig Fehlverhalten an den Tag. Das resultierte wohl aus einer Frustration heraus, bedingt durch die schlechte Bezahlung, mit der das parallel laufende Studium finanziert werden sollte. Auch der unterschwellige Druck, den der Café-Besitzer Hr. Madsen bei seinen Stippvisiten in den Läden seiner Caféhauskette ausübte, war nicht unerheblich. Die Kellnerinnen hatten panische Angst, bei ihren Rauchpausen von ihm ertappt zu werden. Sie telefonierten regelmäßig mit ihren Freunden, um den aufgebauten Stress zu kompensieren und blockten weiterhin jeden Gesprächs- und Flirtversuch der männlichen Kundschaft ab. Diese Melange aus Angst vor dem Chef, Frustration durch die schlechte Bezahlung und Überforderung durch das Abwiegeln der männlichen Singles bewirkte eine gewisse Dynamik in der Arbeitsweise dieser Frauen, die sie für die männlichen Besucher umso interessanter machten. Wenn niemand ihnen ein Handzeichen gab, standen sie meistens gemeinsam an einem Vorsprung am Tresen. Abgesehen von der ersten Stunde nach Ladenöffnung am Morgen, arbeiteten zumeist vier Kellnerinnen gleichzeitig in dem Café. Und sie schauten entweder in den Spiegel hinter dem Tresen oder mit dem Rücken an den Tresen gelehnt in den großen Saal des Cafés hinein. Manchmal hatten sie dabei die Arme vor dem Busen verschränkt, manchmal die Hände in die Hüften gestemmt. Eine hielt sich permanent mit der rechten Hand die rechte Seite des Halses. Manchmal sahen sie dabei aus wie Raubtiere, die nur auf eine Gelegenheit warteten, auf ihre Opfer loszustürzen. Es kam hier fast täglich zu unliebsamen Zwischenfällen. So knallten die Kellnerinnen manchmal im Eifer des Gefechts den Gästen den Kaffee einfach auf den Tisch, dass dieser überschwappte, und sie entfernten sich vom Ort des Geschehens, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Es kam auch vor, dass etwas Kaffee auf die Jacken der Gäste kleckerte, die über den Stuhllehnen hingen. Mal wurde die Kaffeesahne nicht mitgeliefert oder die Zuckerstreuer waren verstopft. Hin und wieder wurden Gäste stillschweigend ignoriert. Dies geschah zumeist, wenn bekannt war, dass sie sowieso nur eine einzige Tasse Kaffe trinken würden und auch kein Trinkgeld geben. Pro Schicht hatte jede Kellnerin einen klar definierten Bedienungsbereich. Einige der männlichen Singles überblickten dies, setzten sich gezielt an einen Tisch, der einer der bevorzugten Kellnerin unterstand. Doch die Frauen waren in einzelnen Fällen so dreist, dass sie sich weigerten, die heimlichen Liebhaber zu bedienen und sie schickten einfach eine Arbeitskollegin in ihre alte Zone, um dem missliebigen Gast zu verdeutlichen, dass er sich besser woanders hätte hinsetzen sollen. Das sorgte häufig für böses Blut und es gab deshalb Streit, bei dem die Kellnerinnen rigoros durchgriffen und mir nichts dir nichts Hausverbot erteilten.
Wer sich der Gunst der jobbenden Studentinnen sicher sein wollte, hatte stets ein angemessenes Trinkgeld zu zahlen, und wehe, jemand überlegte bei der Bestellung zu lange, ihm wurde gesagt, „Ich komme gleich noch mal wieder“, und er musste erfahren, dass er die nächsten 15 Minuten nicht bedient werden sollte.
Doch es gab noch weitere Zwischenfälle. Mal wurde ein verschimmelter Apfelstrudel gebracht, mal wurde aus Versehen zu wenig Wechselgeld herausgegeben. Bitte und Danke war zu Stoßzeiten eher die Seltenheit. Leute, die nicht geduzt werden wollten, wurden geduzt. Leute, die nicht gesiezt werden wollten, wurden gesiezt. Wenn nur Pfennigbeträge als Trinkgeld gegeben wurden, galt das als Provokation, die Kolleginnen wurden darüber informiert, und der Übeltäter mit strafenden Blicken durchbohrt. Wenn ein Gast nach dem Verzehr noch lange am Tisch sitzen blieb, wurde ihm verdeutlicht, dass er allmählich den Laden zu verlassen habe. Dies geschah provokativ während mit einem Wischlappen über einen Tisch gewischt, der Aschenbecher ausgetauscht oder ein vorwurfsvoller Blick in Richtung leerer Tasse oder Glas geworfen wurde.
Oder es wurde aggressiv gefragt: „Möchten sie noch etwas bestellen?“
Eine weitere Maßnahme war eine Unterhaltung mit den Kolleginnen, die nach Blickrichtung, Gestik und Körperausrichtung zu urteilen eindeutig dem zu scheltenden Kunden galt. Einige Café-Gäste fühlten sich von den Kellnerinnen dermaßen gekränkt, dass ihnen der Atem stockte, einigen kochte das Blut, und sie entschlossen sich, nie wieder dieses Café zu besuchen, um Wochen später doch wieder ihre Vorsätze über den Haufen zu werfen. Andere amüsierten sich darüber, dem frustrierten Personal mal wieder zu begegnen. Wegen der permanent wechselnden Schichtbelegung war nie ganz klar, wer am betreffenden Tag arbeiten würde. Zudem konnten die Kellnerinnen untereinander die Schichten tauschen. Einige Gäste versuchten sich dennoch auszumalen, an welchen Tagen welche Kellnerin zu erwarten sei. Anderen Gästen waren diese mitunter sehr frustriert wirkenden Kellnerinnen grundsätzlich egal und sie lasen Zeitungen oder schrieben etwas, ohne die Frauen auch nur eines Blickes zu würdigen.
Selbst das konnte unter Umständen zu Missmut unter den eleganten Frauen führen, und wenn jemand intensiv las oder schrieb lief er ebenso Gefahr von einer Kellnerin angefaucht werden: „Darf es noch etwas sein?“
Äußerte jemand Sonderwünsche, behaupteten die Kellnerinnen, sie fühlten sich schikaniert. Das war immer der Fall, wenn jemand eine zweite Kaffeesahne haben wollte, und die verantwortliche Kellnerin noch ein zweites oder gar drittes Mal extra zum Tisch beorderte. Oder die Kellnerinnen fühlten sich sexuell belästigt, wenn jemand sie auf ihre Kleidung ansprach oder die Frisur thematisierte. Einige der Frauen fühlten sich zutiefst beleidigt, wenn sie nach ihrem Herkunftsort befragt wurden, dazu Rede und Antwort stehen sollten, um nach dieser Zwangspause wieder den ihnen zugeteilten Bereich nach Bestellungen abzurennen, und wohlmöglich die bisher erteilten Bestellungen wieder zu vergessen. Nichts war peinlicher, als ein zweites Mal zum Kunden zu gehen, um sich wegen der Bestellung zu vergewissern. Sie ignorierten, wenn es unter der Kundschaft Streit gab, schritten erst ein, wenn sich jemand beschwerte, weil ihm die Zeitung weggenommen wurde oder weil sich die Leute bei den eng beieinanderstehenden Tischen den Zigarettenrauch gegenseitig ins Gesicht bliesen, weil Hunde unter den Tischen winselten, oder weil Frauen sich von Männern angemacht fühlten, weil Leute sich gegenseitig anrempelten oder den sitzenden Gästen beim Vorbeigehen unachtsam die über die Schulter getragenen Sporttaschen ins Genick schlugen, ohne dies zu bemerken.
Die Kellnerinnen hatten außerdem Angst, dass der Besitzer jemanden beauftragen könnte, sich in den Laden zu setzen, um die Kellnerinnen zu observieren, und eventuelles Fehlverhalten weiterzutragen. In dem Café hingen mehrere Spiegel, sodass einige Leute andere beobachten konnten, ohne dass deren Gesichter einander zugewandt waren. Es gab hier die herrlichsten Missverständnisse. Wenn sich mal jemand nur über die Mahlzeiten auf den Speisekarten informieren wollte, galt das für manche Kellnerin bereits als versteckte Provokation, für andere als Flirtversuch oder als plumpe Anmache. Der Kunde hatte genau zu wissen, was er haben wollte, und es wurde ihm nur wenig Bedenkzeit eingeräumt. Zu viele Fragen schafften Misstrauen und der Kunde verschenkte kostbare Sympathiepunkte, die für sein Wohlergehen unwahrscheinlich wichtig waren. Erst wenn eine konkrete Bestellung exakt formuliert war, verhalf das zur Entlastung der gespannten Atmosphäre. Auch wenn der Besitzer immer nur für ein paar Minuten im Café war, hatte jede Kellnerin zu ihm ein persönliches Verhältnis. Er kannte ihre Namen und ein paar Details ihrer Lebensgeschichten. Deshalb glaubten einige Kellnerinnen, was ihren Dresscode anbetraf, aus der Reihe tanzen zu können, und mal ein Brasilientrikot, ein schwarzes Top oder eine braune Strickjacke zu tragen. Andere hielten sich akribisch ans vorgegebene Schwarz mit weißer Schürze. Da in der Stadt die Arbeitslosigkeit bei über 12 Prozent lag, StudentInnen ausgenommen, konnte der Besitzer sich die attraktivsten Bewerberinnen aussuchen. Er sprach Frauen auch auf der Straße an, wenn sie ihm gefielen, fragte, ob sie nicht Lust haben, in einem seiner Cafés zu arbeiten. Diese Methode war erfolgreich. Wenn sich die jungen Frauen bewährten, hielt er über viele Jahre an ihnen fest. Der Streit zwischen Kunden und Kellnerinnen war für ihn eher irrelevant, wenn sonst nichts Gravierendes vorfiel. Hauptsache die Kasse und das Verhältnis zu den für ihn tätigen Frauen stimmten. Das war der Fall, wenn diese Frauen seine Vorgaben demütig umsetzten. Ob sonst noch etwas lief, konnte sich niemand vorstellen.
Der Besitzer war ein Vollprofi, der schon über zwanzig Jahre im Geschäft war. Zu seiner Kette gehörten elf Cafés, er besaß ferner Hotels und Immobilien. Von Außenstehenden daraufhin befragt, klagten die Kellnerinnen häufig über schlechte Arbeitsbedingungen und die miese Bezahlung, und dass es sehr schwierig sei, nebenbei ein Studium aufrechtzuerhalten. Einige Gäste schlugen sogar vor, eine Kellnerinnengewerkschaft zu gründen oder sich sonst in irgendeiner Form zu organisieren. Solche Anregungen wurden anfangs begrüßt, jedoch schnell wieder verworfen.
Viele der Kellnerinnen sahen sich einem Teufelskreis ausgesetzt: Würden sie noch mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, so hätten sie weniger Zeit fürs Studium, würden sie mehr Zeit ins Studium investieren, um es eher abschließen zu können, so könnten sie deutlich weniger Geld fürs Leben verdienen. Einige kellnerten nebenher noch in anderen Cafés oder Bars, andere bekamen von ihren Eltern regelmäßig Geld zugeschossen. Alle paar Monate wurden die Schichten neu eingeteilt. Danach war Schichttausch nur unter genauester Absprache möglich.
Was die Zusammensetzung der Gäste betraf, spiegelte die Szenerie nicht unbedingt den Status der Stadtbevölkerung wieder, denn es waren verhältnismäßig viele Studenten anwesend. Häufig fanden sich hier Berlinreisende ein, die über einen Hinweis im Reiseführer an das Café gelangt waren. Der Bahnhof Zoo war lediglich 300 Meter entfernt. Außerdem befand sich zwei Hauseingänge weiter in Richtung Ernst-Reuter-Platz ein Jugendgästehaus im vierten Geschoss des bulligen Altbaus, links und rechts neben dem Café befanden sich Bücherläden, der eine stark, der andere weniger stark frequentiert. Mal konntest du in dem Café von draußen etablierte Glatzköpfe sitzen sehen, mal strebsame Studenten, die in Arbeitsgruppen für ihr Informatik-Studium schufteten, mal Sportler, die zuvor in den Sporträumen der nahen Universität an Veranstaltungen teilgenommen oder zwei Straßen weiter im Fitness-Center einen Kurs belegt hatten. Viele gingen hier hinein, da sie Bekannte von der Uni oder aus ihrem Wohnumfeld vermuteten, die ein oder anderen hatten an einem der Tische ihre Blind Dates, andere ihre regelmäßigen Sozialkontakte oder Sprachzirkel. Dieser Ort war einer der beliebtesten Treffpunkte weit und breit. An der Wand neben dem Durchgang zur Küche hing ein riesengroßes Gemälde, das das Café selbst darstellte. Die Elemente muteten sehr expressionistisch an, es war viel Schatten zu sehen und die Gesichter waren nur schematisch dargestellt. Ein Betrachter konnte sich auf diesem Gemälde wieder finden, denn es spiegelte perspektivisch den Sitzbereich der Betrachter wieder. Ziemlich in der Mitte des Cafés stand ein Klavier, an dem selten mal jemand die Erlaubnis erhielt, ein eingeübtes Stück zu spielen. Immer wenn in dem Café Hochbetrieb herrschte, waren die Kellnerinnen und der Tresenmann halt besonders gestresst. Sie waren außerordentlich reizbar, reagierten häufig aggressiv und waren ungewollt unfreundlich zu vielen Gästen. Die Mädels pesten durch den Laden und es war ein Wunder, dass nicht mehr Geschirr zu Bruch ging. Das Motto lautete sehen und gesehen werden. Hier trafen sich speziell am Sonntagnachmittag Jungingenieure, frischgebackene Absolventen, Neureiche und Leute, die einfach nur „bluffen“ wollten. Es galt als Prestige, in diesem Café gesichtet zu werden. Manch einer fragte sich, für was man ihn denn halte, ob für einen Künstler, einen Neureichen oder gar für einen bekannten Wissenschaftler. Die Kellnerinnen interessierten sich nicht für den Status ihrer männlichen Kundschaft, denn sie hatten alle ihre eigenen Beziehungskisten, die sich zum Teil schon während der Schulzeit etabliert hatten. Und sie hielten aus Gründen der Unkompliziertheit daran fest.
Der Bus hielt direkt neben dem breiten Bürgersteig an der Terrasse des Cafés, die die Besucher zu überqueren hatten, wenn sie in den Innenbereich gelangen wollten. Nur bis zum Spätsommer standen auch auf der Terrasse Tische, Stühle und Sonnenschirme.
Zu den Heißgetränken wie Kaffee, Tee oder Kakao wurde nie ein Keks mitgeliefert. Der italienische Kaffee kam ständig ohne ein Glas Leitungswasser, wie es sonst in so vielen anderen Cafés der Fall war. Und fragte jemand dennoch nach einem Keks, so wurde er belehrt, das sei hier nicht üblich.
Verlangte jemand dennoch ein Glas Leitungswasser, so wurde es nie ohne Kommentar seitens der Kellnerin gebracht: „Das ist eine Anmache!“, oder „Das machen wir sonst nicht“, oder „Das schafft nur unnötigen Abwasch.“
Der italienische Kaffee stand nicht mit auf der Speise- und Getränkekarte. Bestellte jemand einen, so war dieser als Eingeweihter entlarvt, denn der herkömmliche Kaffee wurde sogar von den Kellnerinnen hinter vorgehaltener Hand als Plörre bezeichnet.
Part 1
Corinthstraße
Wenn erst einmal 1000 Autos und Lkws vorbei gerauscht sind, hast du unweigerlich keine Lust mehr weiterzutrampen. Die Gesichtszüge verhärten sich, die Augen brennen. Je nach Witterungsverhältnissen verkrampfen die Finger, es stellen sich erste Schwindelgefühle ein, wenn permanent rechts neben dir die Kraftwagen durchrauschen. Besonders schlimm ist es vor Ampeln, wenn Busse oder Lkws ihre Abgase mit Ruß ausblasen. Da fragt sich der Tramper, ob 30 Jahre Umweltpolitik, Katalysatordiskussion und Schadstoffgrenzwerte nur eine Maskerade waren, um danach die Umwelt weiter sinnlos zu verdrecken. Doch was denken die Autoinsassen, wenn rechts am Straßenrand ein mehr oder weniger verwegener Typ mit oder ohne Trampschild steht? Halten sie ihn für einen Sittlichkeitsverbrecher, Vergewaltiger oder sogar für einen Mörder? Der Tramper fühlt sich im Extremfall wie eine Prostituierte, die an der Straße darauf wartet, aufgelesen zu werden. Auch beim Tramper geht es um Geld, die Prostituierte am Straßenstrich platziert sich aus Geldnot, um von den Freiern nach dem Akt Geld zugesteckt zu bekommen. Der Tramper stellt sich an den Straßenrand, um Geld zu sparen oder weil er keins hat. Der Vergleich mit Prostituierten kommt bestimmt auch Truckern und PKW-Fahrern in den Sinn. Vielleicht wünschen sich viele Fahrerinnen insgeheim einen kräftigen Tramper neben sich, vielleicht sogar eine heimliche Affäre. Doch die Angst vor Delikten überwiegt bei der Entscheidung einen Tramper am Straßenrand stehen zu lassen. Für den Tramper wird die Trampstelle auf Dauer unweigerlich zu einem heiligen Ort. Jede Facette prägt sich ins Gedächtnis ein, jedes Verkehrsschild, jede Leitplanke, jeder Kantstein, jedes Graffiti und jedes Haus in der näheren Umgebung. Steht ein Tramper zu lange an derselben Stelle, oder erweist sich eine Trampstelle als ungeeignet, verflucht der Anhalter den Ort, und er erinnert sich unter Umständen bis an sein Lebensende an den Tag, an dem er sich die Beine in den A... stand. Spätestens nach einer halben Stunde geht es los mit dem Appetenzverhalten. Erst wird eine Faust in der Tasche geformt, die Füße und Beine werden unruhig, der Tramparm wird gehalten, als wolle er jemand in den Schwitzkasten nehmen, das alles nur, um die Krämpfe zu unterdrücken und die Verspannung im Schulterbereich zu regulieren. Schließlich muss der Tramper seine Reaktionen auf die Autofahrer unterdrücken, muss verhindern, dass er obszöne Gesten widerspiegelt, dass er ausspuckt oder flucht. Ein Tramper kann nicht immer lächeln, kann auch nicht mit jedem Autofahrer Blickkontakt halten. Sobald ersichtlich ist, ein Fahrer wird nicht anhalten, wird ein Wagen weiter hinten anvisiert. Fahren Autos parallel, wandert der Blick hin und her, und es muss die Entscheidung fallen, welcher Fahrer mit einem freundlichen Gesichtsausdruck zum Halten animiert werden soll. Bald fangen die Beine an zu schlackern. Wie ein Dozent vor einem Auditorium geht er ein paar Meter vor und wieder zurück, um danach wieder tief in den Asphalt zu starren. Trampen kann verdammt frustrierend sein. Immer wieder kommt Panik auf: schaffe ich die Tour in der geplanten Zeit? Komme ich hier bis zum Einbruch der Dunkelheit weg? Komme ich in einem Rutsch durch? Hoffentlich fängt es nicht an zu gießen. Wie soll ich reagieren, wenn die Polizei halten sollte?
Noch zu Hause oder erst an der Trampstelle wird das Trampschild erstellt. Darauf erscheint das Kennzeichenkürzel der anvisierten Stadt: HH, B, KI. Dazu brauchst du ein ausreichend großes Pappschild und einen dicken Filzer. Zur Not tut es auch ein Kugelschreiber. Gerade an verästelten Straßenverbindungen ist ein Trampschild stets von Vorteil. In unbekannten Gegenden empfiehlt es sich nach der idealen Trampstelle zu fragen.
Bei starkem Wind und schnell vorbeifahrenden Lkws und Bussen muss der Tramper aufpassen, dass ihm das Schild nicht aus der Hand gerissen wird. Es kann unter Umständen auch zu Kollisionen des Pappschildes mit zu weit abstehenden Außenspiegeln kommen.
Spätestens bei dichtem Verkehrsaufkommen wirst du daran erinnert, dass der CO2-Ausstoß sich niemals wirklich verringern wird, dass die Lügen der Automobilindustrie weitergehen, uns vorgegaukelt wird, schadstoffverbesserte Motoren und Energien würden dies ändern. Doch je älter die Autos werden, desto mehr stoßen sie aus, es gibt immer mehr Autos, Staus, Alleinfahrer, Anhänger, Straßen, Fahrer über 80, Motorräder oder andere motorisierte Fahrzeuge. Und in fast jedem Auto sitzt nur eine Person. Vielleicht wäre es sogar am besten, wenn sich Tramper in einer Vereinigung zusammenschließen, und die Mitglieder ein Identifizierungsschildchen mit Foto und Namen an der Jacke tragen würden – ähnlich wie die Verkäufer von Straßenzeitungen – um den Autofahrern das Argument und die Angst zu nehmen, es könnte sich um einen potenziellen Vergewaltiger handeln. Manchmal ist es wie ein Spuk, die unzähligen Luxuskarossen auf den Straßen zu sehen, die blitzschnell die Spur wechseln, als würden sie jedem Gesetz der Schwerkraft trotzen. Manchmal wirkt es, als hätte ein übergeordneter Algorithmus diese Fahrzeuge zu Gruppen zusammengefügt, die gemeinsam wie ferngesteuerte Carrera-Autos über die Autobahnen einem hoch wichtigen Ziel entgegen jagen. Die funkelnden Designer-Karosserien wirken wie plastisch. Spätestens, wenn die tausendste dunkelfarbige Karosse vorbeigeflitzt ist, glaubst du als Tramper, die Menschen verhungern in Afrika, nur weil weite Teile der Bevölkerung in Europa und anderswo nichts anderes zu tun haben als Luxusgüter zu horten. Aber lassen sich Autos gegen Lebensmittel tauschen? Doch das Schlimmste ist das diabolische Lachen einiger Autoinsassen, die sich fast gar nicht mehr einkriegen können. Sie machen sich über das Schicksal anderer Leute lustig, die sich nicht einmal mehr ein Bus- oder Zugticket leisten können, oder die keinen Platz mehr bei der Mitfahrzentrale gefunden haben. Es wirkt sehr sadistisch, zwischendurch sind wieder Wagen mit verdunkelten Scheiben zu sehen, die mafiaähnlich wirken. Einige fahren im Vorbeifahren ihre Antennen ein oder aus, wechseln dabei servo-beflügelt die Spur – Deutschland, Land der Angeber und Protze. Andere spritzen im Vorbeifahren Reinigungsmittel aus der Düse der Kühlerhaube. Jetzt riecht alles für Minuten nach Geschirrspülmittel. Nicht nur wegen der radikalen Umweltverschmutzung drängt sich der Slogan auf:
„Autofahrer sind potenzielle Mörder!“
Wenn ein Sportwagen hält und automatisch das rechte Seitenfenster einen schmalen Spalt nach unten fährt, brauchst du gar nicht zu fragen, ob er dich mitnimmt.
Richtig gefährlich wird es, wenn der Kantstein hoch ist und ein Schwertransporter haarscharf mit weit abstehendem Spiegel an deinem Kopf vorbei schrammt. Wie ein angeschlagener Boxer musst du einem Schwinger ausweichen, sonst erwischt er dich. Aber auch diese Gedanken sind schnell vergessen, wenn ein Auto aus den endlosen Blechlawinen ausschert, um auf Höhe des Trampers zu halten. Es sind meistens nur die Ausländer, die mitleidvolle Blicke werfen. Alle anderen wirken unterkühlt, ignorant oder sadistisch.
Wenn sie wollten, könnten Tramper die wildesten Geschichten erzählen. Sie können wahre Verkehrsstatistiken erstellen: über defekte Scheinwerfer, aggressives Fahrverhalten, Raserei, Wettrennen, Imponiergehabe, Leute mit Handy am Steuer, telefonierend oder SMS verschickend, Nicht-Blinker, Opfer von defekten Navigationsgeräten, die Anzahl von Personen pro Auto, wo die Hunde sitzen, wo die Zigarette gehalten wird, Frauen am Steuer, Anzahl der Luxuskarossen, angeschnallt oder nicht.
Auch geschlechtsspezifische Unterschiede ließen sich bei den Insassen von vorbeifahrenden Autos feststellen. Fahren zwei Frauen vorbei, wird wenn überhaupt mal ganz dezent nach rechts in Richtung Tramper geblickt. Fahren zwei oder mehrere Männer in einem PKW vorbei, wird zumeist gelacht, gelästert oder wild gestikuliert, manchmal auch gehupt. Männer scheinen deutlich euphorischer auf Tramper zu reagieren als Frauen. Vielen jungen Männern ist anzusehen, dass sie ihre Witze reißen, einige verdrehen regelrecht ihre Köpfe, viele wirken dabei wie Idioten. So würden sich Frauen nie verhalten.
Es kommt vor, dass jemand den Kopf schüttelt oder als Entschuldigung die eigene Fahrtrichtung oder das Ziel mit einer Zeigegeste signalisiert: „Ich bleibe hier im Ort!“, oder „Ich nehme die nächste Abfahrt!“
Das sind fast ausschließlich allein fahrende Männer zwischen 40 und 60, die wahrscheinlich sowieso nie einen Tramper mitnehmen würden. Wenn mal eine Frau leicht zur Seite linst oder lächelt, dann nur sehr zurückhaltend. Dies sind meistens Beifahrerinnen über 50. Sie geben zu erkennen, wie gemütlich es zu zweit in einem Auto sein kann. Junge Partnerinnen auf dem Beifahrersitz tendierten eher dazu, aus dem Augenwinkel den Tramper unauffällig anzublicken, um Coolness zu demonstrieren oder um sich nicht mit dem Partner hinter dem Steuer anzulegen, der eifersüchtig zu werden droht. Doch die meisten haben Mitleid oder Angst.
Die frustrierenden Momente des Trampens ereignen sich, wenn ein Wagen am anderen Ende der Haltebucht oder weiter vorne auf dem Standstreifen hält – am besten noch mit hell erleuchteten Zusatzbremslichtern im Rückfenster – und der Tramper schnappt sich sein Reisegepäck und läuft zum Fahrzeug, doch das Fahrzeug gibt urplötzlich Gas, unmittelbar bevor der Anhalter das Fahrzeug erreicht. Da steigt in jedem Tramper Wut auf. Es ist immer dieselbe Personengruppe, die Tramper verschaukelt: mehrere junge Leute in einem Auto, die offensichtlich noch nicht sehr lange den Führerschein besitzen und lediglich kleinere Vergnügungsfahrten unternehmen. Es sind häufig die gleichen Fahrzeugtypen, schwarze kompakte Billig-Sportwagen mit partiell verdunkelten Fenstern, Heckspoiler und zusätzlich eingebauter Heckbeleuchtung. Vielleicht sind es Bundies auf ihren abendlichen Sauftouren? Manchmal kommt im Tramper das Bedürfnis auf, irgendetwas spontan hinterher zu werfen.
Nachdem sich die beiden Studenten aus Kiel an der Technischen Uni in Berlin eingeschrieben hatten, fanden sie nicht auf Anhieb eine Wohnung. Sie fuhren bereits vor Semesterbeginn mehrmals zu zweit nach Berlin, um ein akkurates Objekt zu finden, mal per Anhalter, mal mit dem Zug und mal mit der Mitfahrzentrale.
Während der ersten Tage der Wohnungssuche waren sie bei einem alten Schulfreund untergebracht. In den großen Stadtmagazinen mit ihren Veranstaltungshinweisen und Kleinanzeigen und in einer Secondhand Zeitung fanden sie mehrere vielversprechende Angebote. Sie telefonierten mit mehreren Inserenten und arrangierten Besichtigungstermine. Zunächst wollten sie sich die Wohnung eines Arabers namens Tarik in Berlin-Schöneberg ansehen, doch als sie am Treffpunkt erschienen und klingelten, erfuhren sie über die Haussprechanlage:
„Die Wohnung ist soeben vergeben worden.“
„Ist das ganz sicher? Ist der Mietvertrag schon unterschrieben?“, hakten sie nach.
„Die Wohnung ist ganz sicher vergeben!“, bestätigte Tarik.
Als Nächstes wurden sie zu einer Wohnungsbesichtigung in den Prenzlauer Berg eingeladen. Das Objekt befand sich im Parterre eines Altbaus in der Stargarder Straße, gleich links davon, gut 50 Meter weiter, befand sich die Gethsemane-Kirche. Mit der Gegend konnten sie sich sofort anfreunden, der Anblick der Kirche war ihnen schon aus den Medien vertraut, denn hier traf sich früher ein Teil der Protest-Szene. Sie klingelten und ein älterer Herr, Mitte fünfzig, in einem Anzug und mit Oberlippenbart öffnete ihnen die Wohnungstür. Nach einer förmlichen und freundlichen Begrüßung bat er sie hinein. Die Zweiraumwohnung war weiß gestrichen. Es standen ein paar alte braune Möbel herum, in beiden Zimmern stand jeweils ein frisch bezogenes Bett mit aufgeblähtem Bettzeug.
„So, das sind jetzt die Zimmer, ich habe dazu noch ein paar Daten“, sagte der Vermittler, öffnete seinen schwarzen Aktenkoffer, ohne dass die Studenten hineinsehen konnten, und holte etwas Papierkram hervor.
In den kühlen Zimmern roch es frisch und muffig zugleich. Wahrscheinlich wurde Raumspray verwendet. In beiden Zimmern hingen mittelgroße Kruzifixe an der Wand. Das stieß die beiden jungen Leute ein wenig ab. Hier hatten offensichtlich zwei ältere Herrschaften gewohnt.
Jetzt ging es um die Eckdaten der Wohnung. Der Oberlippenbart nahm einen fertigen Mietvertrag zur Hand und gab sich alle Mühe, ihnen die Wohnung schmackhaft zu machen. Doch sie empfanden den Preis von 350 DM für die damaligen Ostberliner Wohnungspreise als deutlich überteuert, denn die Wohnung war möbliert und die beiden Zimmer nicht besonders groß. Sie wollten sich die Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen und den Vermieter in den nächsten Tagen anrufen.
Sie hatten den Eindruck, dass der Wohnungsmarkt ein halbes Jahr nach der Wiedervereinigung recht entspannt war. Sie gingen aus dem Haus, gingen kurz zur Kirche und schauten sich das Eingangsportal an, nahmen den Weg zurück am besichtigten Objekt vorbei zum U-Bahnhof Schönhauser Allee.
„Weißt du was, die Zimmer sehen aus wie Sterbezimmer!“, sagte Mikka zynisch.
Die Besichtigung gab ihnen noch weitere Rätsel auf. Es kam ihnen so vor, als seien die Bewohner vor Kurzem verstorben, und ein Außenstehender wollte mit dem Leerstand Geld verdienen. Die Sache kam ihnen nicht ganz korrekt vor. Auch der biedere Vermittler wirkte mit seinem schwarzen Aktenkoffer etwas unseriös. Doch damals wurde viel gemutmaßt.
Die beiden jungen Männer nahmen die U-Bahn in Richtung Alexanderplatz. Sie fuhren diese Verbindung zum ersten und letzten Mal. Der Streckenverlauf mehrerer Untergrundbahnen wurde von den Stadtoberen in nächster Zeit neu arrangiert, um den Verkehr zwischen den beiden Stadthälften wieder zum Fließen zu bringen. Sie konnten nicht ahnen, dass diese U-Bahn später als U2 sogar bis zum Ernst-Reuter-Platz fahren würde, quasi vor die Haustür ihrer neuen Uni. Die U1 hingegen, aus Kreuzberg kommend, fuhr bald hinter dem Wittenbergplatz in Richtung Krumme Lanke weiter und nicht mehr wie gewohnt in Richtung Olympiastadion nach Charlottenburg – schönes neues Chaos.
Sie hatten bereits mehrere Wohnungen besichtigt, als sie in einer Stadtzeitschrift die Annonce der Mitwohnagentur Strack fanden. Sie wählten die angegebene Telefonnummer und vereinbarten einen Termin für einen Besuch bei der Vermittlungsagentur in der Immanuelkirchstraße im Prenzlauer Berg, nahe der S-Bahn-Station Greifswalder Straße. Diese Mini-Firma war in einer stinknormalen Wohnung untergebracht. Herr Strack sah sehr gepflegt aus, war Ende 40, trug eine moderne Kurzhaarfrisur und elegante Kleidung. Jedoch erweckte die goldbraune Tapete in diesen als Büro eingerichteten Räumlichkeiten einen miefigen Eindruck. Nach einer übertrieben freundlichen Begrüßung holte Herr Strack eine Box mit Karteikärtchen hervor, wie sie jeder Geschichtsstudent für seine Zitatensammlung, Geschichtszahlen oder Begriffserklärungen anlegen sollte. Doch Herr Strack sammelte darin die Wohnungsangebote, die er seinen Kunden vorlegte. Er gab den beiden mehrere Kärtchen in die Hände, die ihren Wünschen gerecht wurden.
Es waren ausschließlich Wohnungen in der östlichen Stadthälfte auf den Kärtchen angeboten, darunter viele Objekte in Friedrichshain, Lichtenberg und im Prenzlauer Berg. Sie erfuhren mehr und mehr zuvor unbekannte Straßennamen von dem Herrn. Doch die beiden hatten genaue Vorstellungen, sie wollten weder in einem Plattenbau wohnen, noch zu weit außerhalb des Stadtzentrums. Der Westteil der Stadt sollte von dort gut erreichbar sein. Schließlich notierten sie sich die Daten von drei Wohnungen, die sie in den folgenden Tagen besichtigen wollten. Für den Fall, dass sie sich für eine der Wohnungen entscheiden sollten, hätten sie dem Wohnungsvermittler zwei volle Monatsmieten als einmalige Vermittlungsgebühr zu zahlen, und pro Monat, den sie in der Wohnung verbringen würden, kämen 10 Prozent vom Mietwert als Gebühren an den Vermittler hinzu.
Auf dem Karteikärtchen für das Objekt in der Corinthstraße stand zwar mit Bleistift, dass die Wohnung nur für rund sechs Monate zu vermieten sei, jedoch teilte Herr Strack mit, dass es auch für länger ginge.
Als sie sich von Herrn Strack verabschiedeten, stand bereits ein Ehepaar aus Schweden im Hausflur, das sich ebenfalls für eine Wohnung bewerben wollte, die sie jedoch nur an den Wochenenden zu nutzen beabsichtigten.
Die beiden frisch Immatrikulierten machten sich mit den Wohnungsvorschlägen auf den Weg. Da die zu vermietenden Objekte derzeit unbewohnt waren, sollten sie die Hauptmieter direkt in deren neuen Wohnungen aufsuchen. Es war nicht möglich, die Personen vorher anzurufen, denn jetzt ein halbes Jahr nach der Wiedervereinigung verfügten nach wie vor nur die wenigsten Ostberliner über einen Telefonanschluss. Unter anderem besuchten sie einen Gleisarbeiter namens Michael in seinem Wohnobjekt in der Dossestraße nahe dem S-Bahnhof Frankfurter Allee. Dieser wollte seine alte Bleibe in der Corinthstraße in Friedrichshain nahe dem S-Bahnhof Ostkreuz untervermieten. Er brauchte diese nicht mehr, da er jetzt mit Frau und Kindern in der sehr viel größeren neuen Unterkunft zu Hause war.
Die Studenten waren schon gespannt, da sie sich in einer ganz neuen, geheimnisvollen und ungewohnten Welt bewegten. So weit waren sie noch nicht in das ehemalige Ost-Berlin vorgedrungen.
Sie trafen Michael, den Hauptmieter der zu vergebenden Wohnung, tatsächlich in dessen neuer Wohnung in der Dossestraße an. Er wohnte im Parterre und sie klopften von draußen gegen das graue heruntergelassene Rollo. Der Fernseher lief im Hintergrund, und nach einem Augenblick wurden sie in die Wohnung gelassen. Nachdem Michael den Grund ihres Besuches erfuhr, mobilisierte er einen seiner Nachbarn und dessen Wartburg, bat die beiden jungen Männer mit ins Auto, und sie fuhren zu viert zu der besagte Wohnung in der Corinthstraße. Michael kommentierte während der Fahrt die Umgebung, sagte etwas zum S-Bahnhof Ostkreuz und dem übergroßen Wasserturm. Sie parkten auf dem Bürgersteig in zweiter Reihe. Die Besichtigung dauerte nur wenige Minuten. Die Wohnung erschien den Studenten akzeptabel, sie sollte 400 DM kosten, bestand aus eineinhalb Zimmern, der Küche und einer Toilette auf halber Treppe. Doch die braunen Wohnungsschlüssel wirkten eher wie kleine Kreuzschraubenzieher. Die Unterschiede zu ihrer eigenen Welt reichten bis ins kleinste Detail.
Moritz wurde das Gefühl nicht los, als würde er diesen Michael irgendwoher kennen. Er hatte in den Jahren vor der Wende schon mal ein Schlüsselerlebnis bei seinem insgesamt zweiten Besuch im damaligen Ost-Berlin.
Mikka besorgte zwei vorgedruckte Mietverträge, die sie mit Michael in der Dossestraße ausfüllten. Sie saßen auf dem Sofa, auch Michaels Frau und Kinder waren anwesend, der Fernseher lief leise im Hintergrund. Schließlich baten sie Michael, falls Herr Strack sich erkundigt, ob die beiden Studenten die Wohnung genommen haben, ihm eine negative Antwort zu erteilen:
„Sie erhalten die gesamte Miete direkt von uns, und wir können uns die Vermittlungsgebühren sparen.“
„Damit bin ich einverstanden!“, entgegnete Michael.
In Ruhe und freundschaftlich beseitigten sie alle Ungereimtheiten und setzten ihre Unterschriften unter die Verträge.
Ob Strack sich das Geld letztendlich von Michael wiederholte, erfuhren sie nicht.
Die Studenten waren zufrieden endlich eine Wohnung gefunden zu haben, auch wenn die Wohngegend zu dieser Zeit immer noch ein recht karges Bild abwarf. Die erste Miete bezahlten sie in bar, sie erhielten die Schlüssel und zogen sofort ein in die 1,5-Raumwohnung im dritten Stock des Hinterhauses. Sie ließen das Los entscheiden, wer das große und wer das kleine Zimmer bekommen sollte. Obwohl Mikka den Los-Entscheid gewann, sagte er
„Ich nehme doch das kleine Zimmer, in das große muss ich zu viel Arbeit investieren.“
Und sie versuchten es sich in ihrem neuen Zuhause gemütlich zu machen, soweit ihre Ressourcen das ermöglichten.
Als sie eines Abends einen Spaziergang machten, fragte Mikka:
„Glaubst du, dass Michael in der Stasi war?“
„Ich glaub' nicht, dafür ist er zu bieder“, entgegnete Moritz.
„Stimmt, der wirkt wie eine graue Kirchenmaus. Außerdem war er Gleisarbeiter. Die brauchten wohl einen bestimmten Level in der Gesellschaft“, steuerte Mikka bei.
Moritz gab seine Vermutungen preis: „Ich tippe eher auf Strack, vom Typ kann das hinkommen. Es ist schwer zu sagen. Er hat das neue System schnell begriffen.“
Und Mikka stimmte ihm zu: „Ja, das glaube ich auch. Der scheint abgewichst und skrupellos zu sein. Ich möchte nicht wissen, was der mit seiner Wohnungsvermittlung für einen Reibach macht.“
Moritz war vor der Wende bereits mehrmals im ehemaligen Ost-Berlin, das erste Mal 1984 auf Klassenfahrt. Sie wurden im Jugend-Sporthotel in Schöneberg direkt am Babystrich einquartiert. Er war gerade sitzen geblieben und seine neuen Schulkollegen hatten ihn noch nicht so recht akzeptiert. Sie gingen damals für einen Nachmittag geschlossen in die östliche Stadthälfte.
Auf dem Programm stand ein Besuch im Zeughaus. Den restlichen Nachmittag durften sie in kleinen Gruppen selbst gestalten. Sie gingen zu viert in die Schwimmhalle im SEZ im Prenzlauer Berg, aßen einen Gänsebraten irgendwo in Pankow. Als Schüler freuten sie sich über die tiefen Preise. Sie tranken eine ganze Menge Bier.
Er hatte nicht mehr viele Erinnerungen an den restlichen Nachmittag. Ein Schild mit der Aufschrift „Abgang“ auf dem Bahnhof Alexanderplatz konnte er nicht mehr vergessen. Das hing auch sieben Jahre später noch dort. Er wunderte sich über die Fahrkartenautomaten in den Straßenbahnen, in die sie 20 Ost-Pfennige einzuwerfen hatte. Doch die Fahrkarten-Ausgabe funktionierte auch ohne Geldeinwurf. Das war für die Schulklasse ein großer Lacher. Sie hatten ihre Vorurteile, für sie hatte wirklich alles eine schlechtere Qualität als zu Hause im Westen. Sie diskutierten lange über die Unterschiede.
Später bekam ein Klassenkamerad Ärger mit einer Prostituierten in der Kurfürstenstraße in unmittelbarer Nähe des Jugend-Sporthotels. Der Schüler schoss ein Foto, während die Frau an der Straße anschaffen ging. Die Frau wirkte auf den ersten Blick eher wie eine Journalistin.
Sie lief schreiend auf ihn zu: „Von mir machst du keine Fotos!",
riss ihm die Kamera aus der Hand, öffnete sie, holte den Film heraus, warf diesen auf den Boden und zertrampelte ihn mit ihren High Heels.
Danach gab sie ihm den leeren Fotoapparat wieder. Der Schüler zeigte dabei keine Spur von Widerstand und lächelte verschämt, bis er sich wieder seinen Schulfreunden anschloss. Er hatte einen hochroten Kopf. Langsam wurde den Schülern klar: im näheren Umkreis vom Hotel ist die Hölle los.
In der Nähe des Magdeburger Platzes, keine fünf Minuten vom Jugendhotel entfernt befand sich die Diskothek „Sound“, bekannt aus dem Roman „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Sie wagten sich damals als Schüler einmal am frühen Abend gegen 20 Uhr in diese Hard-Rock-Disco. Es war noch nichts los, sie waren fast die Einzigen hier und trauten sich sogar auf die Tanzfläche. Sie spielten Luftgitarre. Natürlich hatten sie zuvor eine Menge Alkohol konsumiert.
Sehr beeindruckt waren sie von den Geister-U-Bahnhöfen, die vermutlich auf Ost-Territorium lagen, jedoch von den Westberliner U-Bahnen, die an einigen Stellen die Grenze überschritten, nicht angelaufen werden durften. Die U-Bahnen rauschten dort mit unverminderter Geschwindigkeit vorbei. Nur am U-Bahnhof Friedrichstraße durfte offiziell gehalten werden, und an den typischen goldgrauen Kontrollstationen wurden Grenzkontrollen durchgeführt. Sie wollten unbedingt noch ein Gruppenfoto an der Mauer aufnehmen. Sie suchten sich eine Stelle mit ansprechenden Graffitis, lehnten sich an das an das Bauwerk und baten einen Passanten, ein Foto zu schießen. Ein schönes Erinnerungsfoto.
Bei seinem zweiten Ost-Berlin-Besuch, nach dem Abitur 1988, fuhr er mit seiner damaligen Freundin per Mitfahrzentrale. Es gab Probleme am Grenzübergang Gudow. Die Grenzbeamten ließen den PKW eine Dreiviertelstunde direkt neben dem Kontrollhäuschen parken.
Schließlich hieß es, „Das Auto hat einen Achsenbruch, so können wir sie nicht weiterfahren lassen!“
Das Auto musste wenden und fuhr zu einem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn.
Doch der herbeigerufene ADAC-Mitarbeiter betonte „Achsenbruch sagt er... Ich kann hier nichts finden. Das Auto ist in Ordnung.“
Sie versuchten es ein zweites Mal und durften diesmal ohne weitere Kontrolle passieren.
Sie quartierten sich bei dem Cousin der Freundin in der Elbestraße in Neukölln ein. Während des viertägigen Berlintrips fuhren sie für einen Nachmittag in die östliche Stadthälfte. Sie nahmen den Übergang Friedrichstraße und liefen einfach drauflos. Moritz wollte aus irgendeinem Grund in Richtung Uni-Campus, doch ihm fehlte die Orientierung. Sie liefen die Friedrichstraße in Richtung Oranienburger, als plötzlich ein Lada neben ihnen hielt, in dem sich zwei Personen in Zivil befanden. Die Person auf dem Beifahrersitz stieg aus und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Er ging weiter auf sie zu und forderte die Reisepässe. Mit Widerwillen aber ohne Gegenrede holten die beiden jungen Leute ihre Papiere aus den Jackentaschen und gaben sie dem Mann, der eine Art Schiffermützen-Replikat trug. Er warf nur einen kurzen Blick auf die Pässe. Schließlich erhielten sie die Dokumente unspektakulär zurück und durften weitergehen. Der Lada entfernte sich in Richtung Oranienburger und der Spuk war vorbei. Doch der Nachmittag war für sie gelaufen. Sie stritten sich miteinander, hatten wegen der unplanmäßigen Kontrolle Angst, dass es weitere Probleme geben könnte. Es war, als wollten die ihnen einen Dämpfer erteilen.
Jahre später fragte Moritz sich mehrmals, ob der Wohnungshauptmieter namens Michael, an den sie die Mitwohnagentur Strack vermittelt hatte, dieselbe Person gewesen sein könnte, von der die beiden damals auf ihrem Kurzbesuch in Ost-Berlin kontrolliert wurden. Doch er verwarf diesen Gedanken wieder, auch wenn beide eine vergleichbare Statur besaßen und einen breiten Oberlippenbart mit leichter Krümmung an den Mundwinkeln. Der Vergleich war ihm zu wahnwitzig, spiegelte aber durchaus ihre geistige Verfassung zu der Zeit wider.
Vor der Wende fuhr Moritz ein weiteres Mal per Mitfahrzentrale mit seiner Freundin nach Berlin, diesmal war der Fahrer ein freundlicher Iraner. Auf der Fahrt Richtung Berlin hörten sie im Radio von einer Flugzeugkatastrophe. Terroristen hatten ein Passagierflugzeug über dem Iran zur Explosion gebracht. Sie diskutierten mit dem leicht erregten Iraner das Unglück. Er wirkte sehr betroffen, da über die Hintergründe noch nichts bekannt war.
Und fast genau ein Jahr vor der Wende war Moritz mit seiner damaligen Fußballmannschaft als aktiver Spieler in der DDR. Die dritte Mannschaft des SV Friedrichsort spielte zwar nur in der Kreisklasse-A, doch nachdem die Vereinsoberen eine Bewerbung für ein Freundschaftsspiel an den DFB geschickt hatten, erhielt „Die Dritte“ per Losentscheid die Erlaubnis für ein Freundschaftsspiel in den Staat links der Oder einzureisen. Das entsprach den offiziellen Vereinbarungen zwischen DFB und DFV. Und so fuhr eine Fußballmannschaft des SV Friedrichsort zu Traktor Herzberg in der Nähe von Neuruppin.
Einer der Spieler aus dem Westen hatte „etwas zum Rauchen“ dabei. Bevor sie die Grenze passierten, nahm er das Gehäuse der Hupe vom Lenkrad und versteckte darin die rund zwei Gramm Dope. Sie zeigten die Erlaubnis vom DFB und DFV vor und durften ohne weitere Grenzkontrollen einreisen. Die fünf Autos mit Kieler Kennzeichen kamen sicher in Herzberg an.
Sie übernachteten im örtlichen SED-Heim, bestritten ein Freundschaftsspiel und nahmen an einem kleinen Hallenturnier teil. Gemeinsam gefeiert wurde nicht. Die Mannschaftsfeiern fanden weitestgehend getrennt statt. Nur die Offiziellen aus Herzberg, einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, drängten sich auf. Der Erfahrungsaustausch spielte sich auf einer recht informellen Ebene ab: förmliche Begrüßung, zurückhaltende Gespräche, viel Händeschütteln, viel Heuchelei. Am Abend tauchte lediglich ein ostdeutscher Spieler an ihrer Unterkunft auf, der angetrunken an der Treppe zum Vereinsheim ein Gespräch suchte. Sie merkten, dass er Angst hatte, mit ihnen offen zu reden. Er erzählte vom Alkoholkonsum seiner Mannschaftskollegen, dass mehrere betrunken mit dem Auto nach Hause gefahren seien.
„Kontrolliert die Polizei denn gar nicht hier auf dem Lande?“, fragte einer der Gäste.
„Nein, das ist hier allen egal. Die kennen sich alle untereinander!“, antwortete der Spieler aus Herzberg.
Am zweiten Tag waren sie in ein Sportleistungszentrum am Fehrbelliner See eingeladen, wo es in einer großen Kantine eine Sportlermahlzeit gab. Sie besichtigten das Gebäude und nahmen schließlich noch an dem abschließenden Hallen-Turnier mit Vereinen aus der Region teil. Es ging gut zur Sache. Der überwiegende Teil der Halle war mit Spiegelwänden verkleidet. Das störte einige der Spieler. Am Ende dieser Mannschaftsfahrt hielten die Gäste kleine Wimpel von Elektronik Neuruppin in der Hand, die zwar kleiner, aber besser verarbeitet waren als ihre eigenen, die sie verteilten. Doch die witzige Vermutung kam auf, dass diese „Anhängsel“ beider Seiten von ein und demselben Betrieb hergestellt wurden. Auch die paar Ingenieure in der Gast-Mannschaft hielten sich intern mit harten politischen Äußerungen nicht zurück.
Nach einer förmlichen Verabschiedung traten sie die dreieinhalbstündige Heimreise an. Wie schon auf der Hinfahrt verlief alles komplikationslos.
Erst unmittelbar nach der Wende kam es zum Gegenbesuch einer Mannschaft von Traktor Herzberg. Alle schienen wie geläutert. Nur die Offiziellen von damals waren nicht mehr dabei. Sie waren wegen ihrer früheren Tätigkeit in Verruf geraten. Es hieß, die hätten zum Teil Firmen gegründet. Einer der Brandenburger Freizeitsportler blieb sogar in Kiel. Ihm wurde Arbeit im örtlichen Rüstungsbetrieb angeboten.
Moritz war noch ein viertes und letztes Mal unmittelbar vor der Wende im alten Ost-Berlin. Es war in den Wochen vor der Maueröffnung, nur wenige Tage, bevor Erich Honecker zurücktrat. Sie quartierten sich für ein paar Nächte bei Winnie, einem alten Schulfreund, in der Utrechter Straße in Wedding ein. Sie wollten das Konzert der Bands "Bad Brains" aus den USA und "Jingo de Lunch" aus Berlin im „Metropol“ am Nöllendorfplatz besuchen. Das Konzert wurde ein mitreißender Erfolg. Die meisten Fans tanzten mit freiem Oberkörper. Nur Moritz behielt seine Lederjacke an. Der Saal tobte. Als sie am nächsten Tag den Fernseher anschalteten, startete wie von Geisterhand eingeblendet ein Bericht über das Konzert vom Vortag. Plötzlich sah Moritz sich selbst im Fernsehen, wie er in der tobenden Menge in seiner Lederjacke auf seinen Vordermann aufbockte. Sie konnten es nicht fassen, es war ein Berliner Regionalprogramm.
Am folgenden Nachmittag wollten sie die andere Stadthälfte besuchen. Zu dritt nahmen sie den Grenzübergang Bornholmer Straße, wo sie den Zwangsumtausch von 25 DM pro Person bar bezahlen mussten. Doch sie hatten zuvor bereits legal bei der Berliner Bank 50 Westmark in Ostmark umgetauscht – eins zu 14 – um mehr Spielraum für Bücher und Schallplattenkäufe zu haben. Es war jedoch untersagt, Ostmark in die DDR einzuführen. Sie fragten sich, weshalb die Banken das Geld trotzdem zu diesem Tauschverhältnis anboten, laut Gesetz durften sie ja nur die 25 Mark Zwangsumtausch mitnehmen. Wahrend des Stadtbummels kauften sie Bücher und Schallplatten ein, darunter ein Mitschnitt vom „Festival des politischen Liedes“. Das restliche Geld gaben sie in einer Kneipe aus. Die drei jungen Männer waren stark angetrunken, als sie abends wieder am Grenzübergang eintrafen. Es war schon dunkel. Auf den letzten Metern wurden sie von einem Grenzbeamten vom Wachturm aus beleidigt, der sie schon beobachtet hatte, als sie sich näherten.
Er schrie zu ihnen herunter: „Wie lauft ihr denn überhaupt herum. Könnt ihr euch keine anständige Kleidung leisten?“
Moritz ließ sich auf ein kurzes Wortgefecht ein: „Was schreien sie uns denn so an? Meinen sie, sie sehen besser aus?“, rief er mutig die zehn Meter zu dem aufgedunsenen Uniformträger hoch.
„Seht zu, dass ihr weiterkommt!“, tönte es noch einmal, und sie gingen die restlichen Meter bis zur Grenzkontrolle.
Der Grenzsoldat ignorierte, dass die eingekauften Waren pro Person den Betrag von 25 Ostmark weit überschritten. Allein die Schallplatten hatten zusammen einen Wert von über 100 Ostmark. Sie durften passieren.
Später fragten sie sich, wie die Berliner Bank an das Ost-Geld herankam: „Die müssen ja Lkw-Weise Ostmark über die Zonengrenze nach West-Berlin bringen!“, sagte Moritz spöttisch.
Sie waren immer noch in Berlin, als in den Tagen darauf Honecker zurücktrat, sie sahen sein Gesicht überall auf den Bildschirmen in den Schaufenstern der TV-Händler.
Winnie verließ Berlin ein paar Monate nach dem Mauerfall. Er konnte den permanenten Ansturm auf die Regale nicht mehr ertragen. Er brach sein Medizin-Studium ab, zog nach Hamburg und wurde Krankenpfleger.
Als Moritz jetzt gut zwei Jahre nach diesem Besuch selbst in Berlin heimisch werden wollte, agierte er etwas zögerlich. Ihm war die ruinierte Gegend von Anfang an unheimlich.
Und Mikka störte nicht nur, dass die Häuser so kaputt waren, er stieß sich auch an den Menschen: „An der S-Bahn-Station Friedrichstraße laufen ja nur Psychopathen herum.“
„Die sind wohl auf dem alten System hängen geblieben!“, vermutete Moritz.
Die Verkehrsanbindung war passabel, mit der S-Bahn konnten sie vom Ostkreuz direkt bis zum Bahnhof Zoo gelangen. Dennoch wurde das Wort Ostkreuz zum Synonym für eine kaputte Region mit überraschend seltsamen Gestalten. Und überall sichteten sie Skinheads. Kein S-Bahnabteil ohne Skinhead, kein Abendspaziergang ohne Skins und kein Einkauf im Tip-Markt ohne die kurz geschorenen Artgenossen. Viele dieser Typen gingen mit ihren Kampfhunden Gassi, die wild hechelnd an der Leine zogen. Es war schwer einzuschätzen, ob diese sich als Hobbypolizisten aufführen oder Leute erschrecken wollten. Oder setzten sie diese Hunde als Waffen ein? Hin und wieder lasen sie etwas darüber in den Zeitungen.
Zubehör
| Produkt | Hinweis | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
|
15,98 € * | |||
|
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
Details zum Zubehör anzeigen
|
||||
Auch diese Kategorien durchsuchen: Romane & Erzählungen, Geschichte, Startseite - Verlag
Uhlmann: Der Schlund - im Bannkreis der Naturgewalten
Menschen treffen auf Naturgewalten, einige fordern sie heraus 1 Million Volt in die Schläfe, Monsterwellen vor dem Bug, Kinderwagen im Wasserstrudel, Dealergebeine in der Blitzflut ... Der Natur ist das egal. In drei Erzählungen voller Spannung und Exotik entführt der Autor den Leser zunächst in die Inselwelt der Philippinen, er erlebt an Bord eines Containerfrachters die Begegnung mit einem Taifun und in der Hauptstadt Manila den Überlebenskampf der Menschen im Zentrum des Wirbelsturms. Tragisch endet eine aufblühende Liebe im alten St. Petersburg, als ein deutscher Professor während eines Experiments vom Leitblitz eines schweren Gewitters zerrissen wird. In der letzten Erzählung schließlich entwickelt sich eine Routine-Expedition in das berüchtigte Dschungelgebiet des„Goldenen Dreiecks im Norden Thailands zum internationalen Kriminalfall. Von einem Kommando Rauschgiftdealer mit dem Tod bedroht, lockt der Leiter der Expedition den Trupp in einen tödlichen Hinterhalt der Natur. Unser Autor, selbst ständig auf Reisen, besticht durch seine Detailkenntnis und bisweilen hintergründigen Humor.

Klaus-Dieter Uhlmann, von Haus aus Meteorologe, arbeitete am Forschungsinstitut für Hydrometeorologie Berlin, studierte später Journalistik, war stellvertretender Chefredakteur des überregionalen Senders Berliner Rundfunk, ist ausgewiesener Experte in Sachen exotische Länder und Klima mit diversen beruflichen Aufenthalten in aller Welt. Der Autor von zahlreichen literarischen Features im Hörfunk und Sendereihen im Deutschlandradio über den Einfluss atmosphärischer Erscheinungen auf den Menschen, von Print Veröffentlichungen wie „Krankheitsrisiken des Tropenwetters“ (Magazin „Lenz“) u.v.a. bereiste und bereist eine Vielzahl tropischer Länder, publizierte Reportagen und Reisebeschreibungen für die „Berliner Zeitung“. Einige der Ergebnisse und Erlebnisse dieser Reisen finden auch Eingang in Arbeiten für die damaligen Sender Freies Berlin und Rias, später für das Deutschlandradio Kultur sowie für namhafte Magazine und Zeitungen.
Klaus-Dieter Uhlmann: Der Schlund - Im Bannkreis der Naturgewalten, 224 Seiten, Broschur, € 14,98, ISBN 978-3-86992-092-4
Titelbild zum Download (300 dpi)
Leseprobe:
Taifun-Späne
Dokumentarerzählung
Die Natur versteht gar keinen Spaß,
sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge,
sie hat immer recht,
und die Fehler und Irrtümer sind immer des Menschen.
J.W.Goethe
Die Keimzelle
Südsee, westliche Karolinen-Inseln, Republik Palau,
Insel Babeldoab, 30. Oktober, 16 Uhr Ortszeit
An diesem Nachmittag saß der alte Manu auf seinem Lieblingsplatz, einem Brocken Kalkstein, der aus dem Hang über dem Meeresufer ragte, und betrachtete besorgt das unaufgeräumte Himmelsbild. Von hier aus, der Nordwestecke seiner kleinen Heimatinsel, hatte er einen freien Blick auf den Westteil der Südsee, den die Einheimischen das „Philippinenmeer“ nannten, obwohl das namengebende Inselreich fast 1000 Kilometer abseits der Karolinen lag. An klaren Tagen konnte er die irgendwo über den Wassern aufschießenden Köpfe von Gewitterwolken beobachten, die seltsam durchsichtig über den Pazifik trieben und ihre Regenschleier hinter sich her zogen; einige der Türme, die besonders hoch in die Atmosphäre reichten, waren noch in Entfernungen von 200 Kilometern auszumachen.
Heute hatte sich die See erst vor wenigen Stunden mit einem netzartigen Dunst überzogen; hier und da waberte ein zerfasertes Wolkenknäuel aus dem Nebel, schoss in Minutenschnelle in die Höhe, fiel in sich zusammen, wurde wieder eins mit dem Dunst, eine undeutliche Verdickung über der Meeresoberfläche. Mehr als 1 oder 2 Kilometer weit, fand Manu, würde der Kapitän eines Schiffes da unten die See kaum überblicken können.
Manu kannte dieses Gebräu aus Dampf und Hitze, aus dem sich unversehens Regengüsse und Sturmböen losrissen und Schiffe jeglicher Art in Gefahr brachten, aus eigenem Erleben. Er hatte sie nicht gezählt, die Fahrten, die er selbst als Matrose, später als Kapitän eines eigenen, altersschwachen Frachters, der in Manila registriert war, zwischen den Karolinen und den philippinischen Inseln unternommen hatte. Eine Woche hin, eine zurück – viel Zeit, um in den Jahrzehnten etlichen dieser atmosphärischen Wutausbrüche zu begegnen. Und ihnen mit viel Geschick und Wissen um die Tücken des Wetters auf dieser Route zu entkommen. Ein halbes Dutzend Mal war sein Schiff überdies von den Keimzellen künftiger Taifune verfolgt worden, riesigen Wolkenansammlungen, aus denen Sturzregen niedergingen und die Winde wie Hähne in Käfigen umhersprangen, unberechenbar und scharf in ihren Schlägen. Viele dieser Keimzellen, sofern sie westwärts trieben, verwandelten sich 500 Kilometer weiter, vor Luzon, Leyte, Cebu oder einer der anderen Inseln der Philippinen, in leibhaftige Taifune, mutierten zu Sturmsystemen von schwer vorstellbarem Vernichtungspotenzial. Vor zehn Jahren etwa, erinnerte sich Manu, hatte er sich dem Sog eines solchen Ungeheuers nur durch einen Umweg von mehr als 600 Kilometern entziehen können, was ihn nahe an den Rand des geschäftlichen Ruins gebracht hatte.
Damals vertraute er seinem ältesten Sohn das Kommando an und beschränkte sich darauf, die Fahrten zu organisieren und die Wetterrisiken auf den Schiffsrouten abzuschätzen.
Für morgen früh war die nächste Fahrt angesetzt; philippinische Gastarbeiter traten ihren Heimaturlaub an. Und dieser Termin beunruhigte Manu.
Es waren zunächst nur Kleinigkeiten im Verhalten des Wetters, die auf das Ende der gegenwärtigen ruhigen Phase hindeuteten. Seinem Sohn, befürchtete Manu, würden sie wohl entgangen sein. Der „Schauer vom Dienst“, wie Manu den kurzen Regenfall gegen zehn Uhr vormittags wegen seiner Pünktlichkeit getauft hatte, war noch wie an jedem anderen Tag der Woche vorübergezogen, nur hatte er heute fast eine halbe Stunde länger als gewohnt gedauert. Eigentlich war er auch gar nicht „vorübergezogen“, sondern hatte sich an Ort und Stelle, über seinem Kopf, aufgelöst.
Manu stützte die Hände auf den Korallenkalk, drückte sich hoch und kletterte den Hang zu seinem Haus empor. Unter ihm blieb der Nebel über dem Meer zurück. Er nahm das Fernglas und musterte den Horizont. Jetzt erst sah er, was den Regenwolken über Babeldoab den Schwung genommen, die Energie entzogen hatte: Tief im Westen und Nordwesten schien eine Geschwulst aus dem Wasser zu wachsen, eine Zusammenballung vieltürmiger Einzelgewitter zu einem geschlossenen Wolkenpaket, das bereits ein Drittel des Horizonts einnahm und zu dem inzwischen auch der weißliche Eiswolkenschirm über ihm gehörte. Ein künftiger Taifun keimte in der heißen und feuchten Luft auf.
2
Manu sah sich um und wählte einen der neben dem Haus ragenden Palmenwedel als Festpunkt aus, um die Zugrichtung des fernen, sich aufplusternden Wirbels in Erfahrung zu bringen. Als er nach vielen Verrenkungen und wechselseitigem Zukneifen der Augen in die Hocke ging und die Fiederspitze endlich auf eine der markanten Wolkenfahnen wies, war er sich sicher, auch dieser Keim eines Sturms trieb – noch zögernd und mit vielen überflüssigen Kreisen und Ausbrüchen in alle Himmelsrichtungen – auf das Inselreich der Philippinen zu, würde also auch jede Schiffsroute aus Richtung der Karolinen kreuzen. „Keine gute Zeit für eine Reise“, fand Manu. Sein Sohn würde die Fahrt verschieben müssen. Vielleicht.
Bliebe noch der stille Rat des Barometers. Er trat ins Haus zurück und klopfte an das Glas, das neben dem Telefon hing. Der Zeiger, wie überall in den Tropen sparsam in der Bewegung, ruckte diesmal deutlich in Richtung „Schönwetter“; eine trügerische Versprechung, die Manu nicht überraschte, die er fast erwartet hatte; viele Wirbel schoben sie an ihrem Rande vor sich her, bevor der Luftdruck wie ein Stein zu fallen begann und ihre Zentren Zerstörung und Tod verbreiteten.
Er griff nach dem Telefonhörer. Das Gespräch dauerte nur wenige Minuten. Zufrieden legte er auf. Der Sohn vertraute seinem Rat.
*
Zwei Tage nach der Geburt der Unwetterzelle in der feuchtheißen Luft über den Gewässern vor Palau sollte das Wetteramt in Macao den Tropischen Sturm auf den Namen „Bebinca“ taufen; ein – wie die weitere Entwicklung des Wetterungeheuers zeigen sollte – durchaus unglücklich gewählter Name. Handelte es sich doch bei der Wortschöpfung „Bebinca“ um einen süßen Milchpudding, den die portugiesischen Restaurants der Stadt raffiniert zubereiteten und der zu den Lieblingsspeisen der Macaoer gehörte ...
*
Containerfracht
Insel Leyte, Philippinen,
Internationaler Hafen von Tacloban, 30. Oktober, 17 Uhr Ortszeit
Der Golf von Leyte, ein lang gestrecktes Meeresbecken von mehr als 5000 Quadratkilometern Ausdehnung, glänzte im Licht der späten Nachmittagssonne; schwache Winde, die von den fernen Bergen im Osten die Bucht erreichten, kräuselten nur die Wasseroberfläche, die in ein Mosaik von schwarzen, silber- und goldfarbenen kleinen Wellen zerfiel.
Im Hafen überwachte Kapitän Tuoko die Beladung seines Containerschiffs, des „Kleinen Drachens“, und trieb die Schauerleute zur Eile an. Das Wetter gab zwar keinen Anlass zur Beunruhigung, und er war dafür den Göttern dankbar, doch die vor ihm liegende Route war noch lang, zumal er sich entschlossen hatte, von Tacloban aus noch einen Abstecher ins Innere der philippinischen Inselwelt zu unternehmen. Ein günstiges Angebot, ein paar zusätzliche Container auf Cebu abzusetzen, ehe es wiederum von Tacloban aus mit der eigentlichen Beladung in Richtung Osaka, seinen japanischen Heimathafen ging. Die Herren der Reederei würden die Aufmerksamkeit ihres Kapitäns sicherlich honorieren; vorausgesetzt, er blieb im vereinbarten Zeitlimit. Doch in dieser Hinsicht hatte er keine Bedenken; die Meere zwischen Japan und den Philippinen waren zu dieser Jahreszeit derart anfällig für tropische Wetterstörungen, dass Verspätungen durch Wind und hohen Wellengang von vornherein akzeptiert wurden. Es durfte ihm jetzt allerdings nicht auch noch ein ausgewachsener Taifun in die Quere kommen, der ihn in der Zeit zurückwerfen und seine Pläne für einen Extraverdienst zunichte machen könnte.
Zunächst musste aber der Umschlag zügig verlaufen, was in diesen Breiten nicht unbedingt zu den Selbstverständlichkeiten gehörte; hohe Temperaturen und eine besonders lästige Luftfeuchte förderten nicht gerade die Lust an körperlicher Arbeit, und er hatte, vorausschauend, dem Vorarbeiter ein paar Dollar für seine Leute zukommen lassen; aus eigener Tasche, versteht sich.
Die Container standen inzwischen alle auf ihren vorgesehenen Plätzen; Tuoko schlenderte zum kleinen Frachtraum am Bug des „Kleinen Drachens“; auch hier würde die Beladung bald abgeschlossen sein. Einige Gabelstapler rumpelten noch über das grobe Pflaster zwischen dem Kühlhaus des Hafens und dem Schiff, Schauerleute stapelten Kisten mit halb reifen Südfrüchten ein, darüber einige Lagen gekühlter Plastiksäcke mit Orchideen. Der Kapitän konnte sich dem unvermeidlichen Papierkrieg widmen.
*
Aus dem persönlichen Logbuch des Kapitäns Tuoko:
Tacloban, 30. Oktober, 17.30 Uhr Ortszeit
Beladung abgeschlossen. Gegen 18 Uhr Frachtbriefe unterzeichnen. Entbehrlichem Teil der Besatzung bis 19 Uhr frei gegeben.
Hafen seit letztem Umschlag stark erweitert, Rinne vertieft. Ausblick auf lang gezogene S-förmige Meeresbrücke zwischen Layte und Insel Samar genossen; nach wie vor beeindruckend. Die alte Christus-Statue hängt immer noch über der Stadt. Relikt. Siegestrophäe über Japan. Bedauerlich!
Wetter: klarsichtig. Wind leicht böig, Stärke 3 aus Nordost. Barometerstand normal, tägliche Druckwellen zehntelgenau eingehalten. Lockere Staubewölkung am Bergkamm im Osten. Alles o.k.
Aus dem persönlichen Logbuch des Kapitäns Tuoko:
Insel Cebu, Hafen Cebu-City, 31. Oktober, 7 Uhr Ortszeit
Nach 9 Stunden Nachttörn gegen 5 Uhr früh im Hafen angelegt. Nördliche Umfahrung der Insel Bohol mit Untiefen und winzigen Eilanden könnte bei Sturm gefährlich sein; zum Glück gab es weiterhin nur schwache Winde. Vorsichtshalber bis zum frühen Morgen Brücke nicht verlassen. Sehr müde.
Cebu-City erstaunlich verändert. Skyline bis an den Hafenrand. Faszinierend. Auch Fort San Pedro scheint restauriert; soll bis Kriegsende Hauptquartier der Amerikaner gewesen sein. Kostspielig.
Postkarte an Shu abgeschickt; wird sich wundern: gab im Hafen nur „Maggelans Cross“, die erste Bretterkirche bei der Christianisierung. Ist jetzt hübsch getüncht.
Letzte zwei Stunden Früchte und Klimaanlagen ausgeladen. Coprasäcke, Rattanmöbel und ein kleiner Schmuck-Container reisen zurück nach Tacloban.
Sind alle Schriftstücke unterzeichnet, kann ich gegen 8 Uhr ablegen lassen.
Nach Ausfahrt endlich schlafen.
(Nachtrag, ebenda, 8 Uhr Ortszeit)
Ausfahrt pünktlich und reibungslos. Bohol Strait stark frequentiert; Fähren, Urlauberschiffe, Frachter.
Wetter üblich unauffällig; einige Schauerwolken an Land sichtbar. See vor uns fast wolkenfrei. Wind böiger als in der Nacht. Luftdruckanzeige am Barometer normal, allerdings scheint sich die erste Druckschwankung zu verspäten. Sollte ich mir Sorgen machen? Wahrscheinlich noch zu früh.
Anweisung an Ersten Offizier, Barometer im Auge zu behalten; Prüfung alle 15 Minuten befohlen.
Werde im Sessel schlafen.
*
Camotes Sea, östlich von Cebu
31. Oktober, 9 Uhr vormittags Ortszeit
Mit einem unangenehmen Ruck erwacht Kapitän Tuoko aus seinem kurzen Schlaf. Unruhe hat ihn erfasst. In der Kajüte ist es dunkel, stickig und heiß; die dichten Jalousien sind heruntergelassen.
Ein Traum oder eine Unregelmäßigkeit im Schiffsverhalten?
Die Erfahrung aus Dutzenden Fahrten in den taifunverseuchten Gewässern des nordwestlichen Pazifiks rät ihm, seine Aufmerksamkeit zuerst dem Schiffskörper selbst zuzuwenden.
Hat sich die Lage des Ruhepunkts des „Kleinen Drachens“ verändert?
Er kann nichts feststellen.
Ist Dünung aufgekommen oder hat die Richtung des Wellendrucks einen Wandel erfahren?
Noch etwas benommen erhebt er sich aus dem Stuhl, fühlt einige Schritte seitwärts die Sicherungsleinen des schmalen Betts und streckt sich auf der Decke aus, die Arme wie die Flügel eines Vogels zur Seite, als wollte er sich mit jeder Faser seines Körpers dem Schiff verbinden; prüft sein Empfinden ...
Keine ungewöhnliche Krägung; nur das übliche, kaum spürbare Ausholen auf den Wellen. Der Motor brummt zuverlässig-eintönig, er muss nicht kämpfen.
Dann erst hört Tuoko das Hüsteln vor der Kajütentür. Und ein vorsichtiges Klopfen.
„Ja?“
„Der Funkmaat, Herr Kapitän ...“
Sofort kehrt die Unruhe zurück.
Er tastet sich zum Fensterauge vor, zieht die Jalousie hoch. Das Licht der frühen Sonne flutet in den Raum; er kneift geblendet die Augen zusammen. Weit im Südosten gleitet das Mittelgebirge der Insel Bohol über den Horizont.
Der Kapitän öffnet einen Spalt weit die Tür und greift nach dem Papier, das der Maat durch die Öffnung schiebt.
„Warten Sie einen Augenblick.“
Unter der Lampe über dem Kartentisch studiert er aufmerksam die Mail, eine Mitteilung des „Joint Typhoon Warning Centre Pearl Harbor, Hawaii“ (JTWC), das über die Gewitter-Cluster des neuen Taifun-Babys informierte, die sich auf den Weg nach Westen begeben hätten.
Tuoko schließt den obersten Knopf seiner Kapitänsuniform und öffnet die Tür.
„Alle Offiziere, Herr Kapitän?“, erkundigt sich der Maat.
„Alle“, bestätigt Tuoko. „Auf der Brücke. In fünf Minuten.“
„Eine geschlossene Zirkulation also“, bemerkt der Erste und tippt auf die angedeuteten Spiralarme des Wolkensystems auf dem Satellitenbild. „Und nähert sich.“
„Wassertemperatur der Philippinen-See?“, fragt Tuoko dazwischen.
„Mindestens zwei Grad höher als gewöhnlich.“
„Viel Energie aus dem Meer; reicht sogar für einen sehr kräftigen Taifun, bald. ... Schon Prognosen von Hawaii oder vielleicht Miami?“
„Keine; werden sich wohl erst am Scheitelpunkt festlegen.“
Das zum „Scheitelpunkt“ gehörende Seegebiet liegt einige hundert Kilometer östlich der Philippinen. Hier entscheidet die zufällig vorherrschende Anordnung höheren oder niedrigeren Luftdrucks samt Richtung der Höhenwinde darüber, in welcher Richtung der frisch eingetroffene Taifun oder eines der noch „unreifen“ Schlechtwettergebiete weiter zieht. Manche Stürme vollführen erst einmal einige schwer berechenbare Schleifen an Ort und Stelle, geben sich dann plötzlich einen Ruck und stieben in Richtung Südwesten davon, andere – bei den Filipinos ungleich beliebtere – drosseln nur kurzzeitig ihre Zuggeschwindigkeit, beschreiben anschließend eine saubere Parabel und trollen sich Richtung Nordosten davon; was freilich die fernen Koreaner, Südchinesen und Japaner in helle Aufregung versetzt; irgendeinen von ihnen würde der Taifun mit Stürmen und Regenmassen bald beuteln. Schließlich gibt es noch die „Unentschlossenen“, die in der Nähe des Scheitelpunktes lustlos umherschwimmen, zeitweise einen Ausfall in Richtung Japan vortäuschen, danach wieder auf das Festland um Manila zielen, ihre Wirbelgeschwindigkeit plötzlich verdoppeln und innerhalb von Stunden zum Ungeheuer eines Super-Taifuns mutieren, der über die Mitte der Philippinen hinweg rast, alles umher wirft und unter Wasser setzt. Seine Zerstörungswut bekommen oft noch die Vietnamesen, Laoten und Nord-Thailänder zu spüren. Sogar die Inder sind dann nicht mehr sicher.
Verständlich, dass die Taifun- und Hurrikan-Warnzentren erst einmal die Winkelzüge der Wetterungeheuer abwarten, bis sich einigermaßen sicher berechnen ließ, für welche Zugbahn sich der Sturm entscheiden würde.
„Nehmen wir den ungünstigsten Fall an“, sinniert Tuoko und blickt in die unbewegten Gesichter seiner Offiziere. „Gehen wir einmal davon aus, der Wirbel „Bebinca“ zieht – ob noch als Schlechtwetter-Depression oder schon als Taifun – nach der üblichen Verzögerung am Scheitelpunkt nach Nordwesten, kreuzt damit irgendwo nördlich der Insel Samar direkt unseren vorgesehenen Fahrweg in Richtung Nord ... Wann träfe unser Schiff an dieser „Kreuzung“ ein?“
„Schwer zu berechnen“; die Finger des Zweiten gleiten bereits über die Tastatur des Computers. „Wir kennen sein künftiges Tempo nicht. Als Mittelwert“, er zuckt die Schultern, „simuliert der Rechner den 1. November zwischen 12 und 22 Uhr Ortszeit. Aber ob das realistisch ist ...“
„Ist es nicht. Und viel zu ungenau.“
„Immerhin“, wirft der Erste ein, „hätten wir einen Anhaltspunkt, zu welchem Zeitpunkt wir die ominöse „Kreuzung“ verlassen haben müssten, spätesten.“
Der Kapitän nickt. „Wir vertagen das. Vielleicht gelingt es uns, „durchzurutschen“. Vor ihm. Wenn nicht ...“ Er wendet sich dem Zweiten zu: „Prüfen Sie einen Fahrweg möglichst nahe der Küste“, er unterbricht sich, “nicht zu nahe! Und finden Sie ein paar geschützte Buchten in Fahrwegnähe, damit wir notfalls abwettern, uns verstecken könnten.“
Er blickt auf einen Zettel, den ihm der Erste zugeschoben hat.
„Richtig. Der Taifun nähert sich steuerbords; damit hätten wir Gegenwind, aus Nord. Vielleicht bereits Sturm. Wird Zeit kosten. Einplanen!“
„Wenn wir wieder in Tacloban sind ...“, der Erste hatte sich dem Maschinen-Ingenieur zugewandt, „könnten wir die Liegezeit verkürzen?“
„Nein, wir sind bereits an der Grenze des Machbaren.“ Die Augen des Ingenieurs huschen Hilfe suchend zum Kapitän. „Zwölf Stunden habe ich, noch dazu bei Nacht. Alle Zylinderkopf-Dichtungen müssen überprüft, gegebenenfalls ausgetauscht werden. Die Reederei ...“
„Halbieren Sie die Anzahl“, wirft der Zweite ein.
„Wie denn? Und wenn uns der Taifun am Schwanz packt? Wenn Bug und Heck abwechselnd hart auf das Wasser schlagen und die Schrauben zwischen zwei Stoßwellen in der Luft hängen? Wenn dann der Motor nicht fit ist – wollen Sie das verantworten?!“
„In Ordnung“, der Kapitän hebt die Hand, um den Streit abzubrechen, „Unter zwölf Stunden geht es nicht. Danke, meine Herren.“
Er dreht sich zum Fenster um, starrt hinaus, müde. Der Himmel über der See ist wolkenlos.
*
Boten
Philippinen, nördlich der Insel Samar, 1. November, 8 Uhr Ortszeit
In einer kleinen Bucht des Eilands Batag, gut 250 Kilometer von Tacloban im Süden entfernt, landeten drei Boote einer örtlichen Fischer-Kooperative mit dem frischen Fang dieses November-Morgens. Die Fischer, seit 2 Uhr nachts unterwegs, waren erschöpft, aber zufrieden. Die beidseitigen Ausleger der Katamaran-Boote lagen tief im Wasser und bogen sich zum Rumpf der Kähne hin deutlich durch; viele Fische, gutes Geld.
Ein kleiner Trawler würde den Fang nach Cartaman schaffen, der nächstgelegenen Küstenstadt im Norden von Samar. Die Fischer schaufelten die zappelnde Beute in flache Kisten, wateten mit ihnen – bis zur Brust im Wasser – rund hundert Meter durch den Uferschlick und klemmten die schweren Behälter an das untere Ende eines Seilzugs, der vom rundbödigen Trawler in der Fahrrinne herabbaumelte.
„He Chef“, wunderte sich Matahino, der Jüngste der Fischer, „die Quallen sind weg.“
Er sicherte die letzte Kiste zum Hieven und sah sich ungläubig um.
Die Schwärme von Küstenquallen, die ansonsten das Umladen des Fangs zu einer unappetitlichen Angelegenheit machten, mit ihren schleimigen Körpern und den brennenden Nesselfäden die nackte Brust und die Beine quälten, waren wie ein Spuk in den Weiten des Meeres verschwunden. Klar und deutlich sichtbar schienen heute die Unterwasser-Klippen der Bucht im leichten Wellengang zu wippen, als habe es die Gallert-Glocken nie gegeben.
„War zu erwarten“, erwiderte Maha, der Führer des Trupps und wies mit dem Kopf zum Osthorizont. Knapp 20 Grad hoch über dem Meer, bis an den unteren Rand der Sonnenscheibe reichend, stand eine zimtfarbene Wand von Schleierwolken; einige Fäden schienen dem Licht hinterher eilen zu wollen und schoben ihre Krallen bereits über das Tagesgestirn; ihre Säume irisierten in den Farben des Eisbogens.
„In Manila sagen sie „Ziegelstaub“ zu dem Himmel“, ergänzte ein graubärtiger Mann mittleren Alters, der weiter herumgekommen war, als seine Arbeitskollegen.
„Schon gehört“, sagte Maha. „Es ist der Neue. Ein Taifun. Wahrscheinlich. Quallen haben Respekt vor Sturm; sind auf offener See besser aufgehoben, als zwischen den scharfen Klippen, wenn die Brandung über die Insel geht. Einen sechsten Sinn haben die Biester.“
Und nach einer Pause:
„Der ferne Gesang der Wellen hat sie wohl in die Flucht geschlagen.“
Er starrte auf das Wasser.
Jetzt musterten auch die anderen beiden Fischer die Oberfläche des Meeres. Auf den ersten Blick schien es das gewohnte Bild: ein leichter Wellengang – mit dem vorherrschenden Wind aus Nordost hereinkommend, flache Kämme, aber – der Jüngere bemerkte es zuerst – in größeren Abständen erfasste eine Riffelung die schwache, einheitliche Brandung, Querwellen, die – noch bedächtig – von irgendwo her, aus dem Südosten einliefen und die örtliche Windsee kreuzten.
„Dünung aus dem Sturm“, flüsterte Maha. „Bald wird sie mächtig das Meer beherrschen, am Nachmittag oder Abend vielleicht.“
„Oder früher“, mutmaßte der Graubart.
„Nur Gott weiß, wann“, murmelte Maha, und – nach einer weiteren Pause:
„Genug Zeit für uns.“
„Zeit wofür?“ Die Frage kam fast gleichzeitig von den beiden anderen Fischern.
„Wir holen noch die Lobster-Kästen ein.“
Hummerfang war die zweite wichtige Einnahmequelle der Fischer. Nahte ein Sturm, mieden auch die bis zu fünfzig Zentimeter langen Panzerkrebse die Küstennähe, schwammen ein, zwei Kilometer hinaus und vergruben sich im Sand des Meeresbodens. Hatten die Fischer dort rechtzeitig ihre Lobster-Fallen aufgestellt, grob geschweißte eiserne Käfige, wählten viele dieser Krebse sie als Schutzbehausung vor dem Sturm. Die Kunst bestand darin, die Fallen erst wieder an Bord zu holen, wenn sich die Tiere im Käfig auch wirklich eingefunden hatten, und dies andererseits so rechtzeitig zu managen, dass man selbst vom aufkommenden Sturm ungeschoren an Land kam.
„Hol Trockenfisch und Wasser vom Stützpunkt“, wies Mahe den Jüngsten an.
Der Bärtige nickte ihm zu. „Vor Nachmittag werden wir kaum zurück sein. Ein Risiko allemal.“
„Wenn alles gelingt“, sagte Mahe langsam, „kannst Du für eine Woche deine Familie in Manila besuchen. Wir werden Geld haben.“
Er blickte zum Wolkensaum über der See, der eine rot-goldene Färbung angenommen hatte. Weiter unten, dicht über dem Horizont, trieben einige hässliche graue Nebelwolken über dem Wasser.
„He, Matahino“, rief Mahe dem Jüngsten hinterher, „sag den Leuten, sie sollen das vollgetankte Motorboot bereithalten. Vorsichtshalber. Vier Uhr nachmittags vielleicht.“
*
Manila
In Deutschlands östlicher Mitte, in Berlin, ging der Herbst mit Schneeregen und ersten nächtlichen Frösten allmählich in den Vorwinter über. Ich saß im Arbeitszimmer unseres Hauses am Stadtrand und betrachtete missmutig die vorübertreibenden nassen Schwaden, die sich im Geäst der Bäume verfingen, hinter den Stämmen Pirouetten drehten und mit jeder Windböe halb körnige Rinnsale an die Fensterscheiben malten. Im Stadtzentrum selbst war wenig von dieser Tristesse zu bemerken; Geschäfte, Busse, Bahnen sorgten für sommerliche Komforttemperaturen, Schnee blieb ohnehin selten liegen, und wenn es schon einmal zur Ausbildung einer dünnen Schneedecke kam, fanden sich die Bewohner damit ab, dass die Stadt zwei Stunden später den Verkehrs-Kollaps erlitt; nicht zu reden vom allgemeinen Katastrophen-Alarm, wenn hin und wieder ein „Jahrhundert-Orkan“ in die Straßenschluchten fuhr, ein paar Ziegel von den Dächern rutschten und Presse und Fernsehen jede einzelne Schindel porträtierten. „Alles Humbug“, würde Oskar Rappa sagen, ein guter Bekannter von der Karibikinsel Guadeloupe, der dort schon einige Gruppen europäischer Touristen vor nahenden Hurrikans in Sicherheit gebracht hatte, und nicht nur seine Heimatinsel, sondern – aus Armeetagen – auch Deutschland mit seinem Hang zu eingebildeten Wetter-Dramen wie seine eigene Rasta-Frisur kannte. „Euer Wind hat ein Gerüst umgestürzt? Unser Hurrikan kippt alle um, zerhackt sie auch noch zu Kleinholz, und wenn zufällig ein Holzspan übrig bleibt, jagt er ihn zentimetertief in die Rinde des nächstbesten Baums, der noch nicht auf das Nachbarhaus gefallen ist. Das eignet sich zur Schlagzeile!“ Dann würde er sich zufrieden zurücklehnen, mich angrinsen und ein Gebet für sich, seine Kinder und seine wieder schwangere Frau sprechen, dass Gott sie auch weiterhin vor jedwedem Wetter-Unbill beschützen möge.
Der Gedanke an Oskar, den klugen, freundlichen Insulaner, der nie Zeit zu haben schien, und es doch immer irgendwie schaffte, seiner Familie nah zu sein, hellte meine Stimmung ein wenig auf. Ich dachte an Freunde und Bekannte an einem anderen Ende der Welt, in Manila, die jetzt seit Wochen meinen angekündigten Besuch erwarteten, auf Neuigkeiten und Grüße von Verwandten aus ihrer deutschen Heimat hofften. Freilich wussten sie ebenfalls, dass ich – wie zuvor in der Karibik – nicht ihretwegen auf Reisen ging, sondern mit einem der verderblichen Taifune, wie die Hurrikans in Asien hießen, verabredet war, Stoff sammelte, wie die Menschen in dieser Weltregion in ihrem alltäglichen Leben mit der größten Gefahrenballung, zu der das Wetter in der Lage war, umgingen, wie sie bestanden.
Nur, ich konnte den Taifun nicht herbei pfeifen; ich konnte lediglich die Arme verschränken, in das widerliche deutsche Winterwetter starren und ebenfalls warten.
Ich ging zum Computer hinüber.
*
Berlin, 31. Oktober
Die Anzahl der Taifun-Geburten im Nordwest-Pazifik begann endlich zuzunehmen. Zunächst hatte ich mich in das Warn-Center von Miami, dann – als der Wettersatellit am 25. ein Knäuel Gewitterwolken nahe der Südsee-Insel Yap ausgespäht hatte – in das Center von Hawaii eingewählt. Die Experten hatten den Cluster ebenfalls ins Visier genommen; seitenweise verließen verschlüsselte Zahlenkolonnen ihre Großrechner, belegten die Verwirbelung zum Tropensturm, schließlich – am 27. – seine Verwandlung in einen Taifun, der Kurs auf die Philippinen nahm. Auch einen Namen besaß das Ungeheuer bereits: Die laotischen Meteorologen hatten es „Xangsane“, der „Elefant“, getauft.
Doch die Kapazitäten selbst von Großraum-Fliegern sind nicht unerschöpflich, und so fand sich nirgendwo eine Chance, rechtzeitig vor Ankunft dieses Taifuns in Manila die Metropole der Philippinen anzufliegen.
Erst heute früh schien eine erneute Anfrage bei den Fluggesellschaften sinnvoll: In einem der Fünfer-Codes von Hawaii tauchte überraschend eine frische Positionsangabe auf; sie deckte sich ziemlich genau mit dem heißen Meerwasser-Areal, das schon dem „Elefanten“ als Kinderstube gedient hatte, irgendwo im Westteil der Karolinen-Inseln. Noch sah das hier herumschwimmende Wölkchen – aus der Sicht des Satelliten – harmlos aus, fand ich, wären da nicht ein paar lockige Nebelsträhnen gewesen, die sich zögernd um den Mittelpunkt der Hauptwolke wanden, den Beginn eines Wirbels andeuteten. Ob dieses Gebilde tatsächlich die Kraft zu einem Tropensturm oder gar zu einem Taifun finden würde, stand noch „in den Sternen“, erst recht, ob es der Spur des „Elefanten“ zu folgen wünschte und – größtes Fragezeichen – auch noch seinen Weg über Manila nahm. Möglicherweise liefe alles auf eine Fehlinvestition hinaus und ich säße die nächste Woche unter einem Sonnenschirm an der Manila-Bay herum ...
Ich sah in den Garten hinaus; nichts hatte sich wesentlich verändert, nur, dass sich die Grasnarbe auf einigen alten Maulwurfshügeln langsam mit einer weiß-grauen Schlammschicht überzog, Schnee.
Ich rief den Flughafen an.
Angst vor der eigenen Courage?
Natürlich war wider Erwarten ein Platz in einer Maschine der British Airways frei ...
*
Manila, Philippinen, 1. November
Nachdem die Boeing gegen 8 Uhr früh gelandet war, hatte ich noch vom Gepäckraum des Flughafens aus das Hotel angerufen, in dem ich schon einige Male übernachtet hatte. Von Nachteil war, dass es unmittelbar neben dem Rotlichtviertel lag, die Nächte gewöhnlich laut und mit grellen Lichtern in die Zimmer drangen; dafür war es preiswert, und die legendäre Manila-Bay mit ihrem fantastisch freien Blick auf eintreffende oder abgehenden Taifune befand sich nur wenige Meter entfernt jenseits des Roxas-Boulevards.
Das Hotel mit seinen festen Quadersteinen schien „Xangsane“ gut überstanden zu haben; zwar war der reguläre elektrische Strom gerade wieder ausgefallen, doch da dies in den wenigsten Fällen irgendwelche Taifune verschuldeten, hatten die Anwohner der Straße ihre stets einsatzbereiten benzingetriebenen Notstrom-Aggregate auf den Bürgersteigen angeworfen, und schwere Wolken schwarzen und gelben Rauchs wallten an den Häuserwänden entlang.
Immerhin funktionierte dadurch die Klimaanlage, und ich legte mich, notdürftig gewaschen, auf die Steppdecke und schlief sofort ein.
Es war schon später Nachmittag, als ich mich auf den Weg zur Bay machte. Vom Roxas-Boulevard aus, der der Küstenlinie folgte, führten breite, vor knapp vier Tagen von den Regenfluten des „Elefanten“ ausgewaschene Rinnen zum Meer hinunter; und es glitzerten sogar noch einige Wasserlachen zwischen den Palmen des Hains. Die Mehrzahl der Bäume hatte dem Orkan offenbar getrotzt; zwei, drei abgedrehte Stämme, zu Haufen gewehtes Blattwerk und ein Stapel nasser Bretter, der einmal den Fischern als Schuppen gedient hatte, waren die einzigen Artefakte „Xangsanes“. Auch Teile einer niedrigen Steinmauer, die den Hain zum Strand hin begrenzte, standen noch, und Kinder an der Hand ihrer Väter kletterten in den Resten herum. Der Himmel über der Bay zeigte ein tiefes sattes Blau, in dem sich die immer noch grelle Sonnenscheibe merkwürdig fehl am Platz ausnahm.
Auf dem Rückweg bog ich wenige Kilometer von der Padre Faura Street entfernt in das Viertel der Armen des Bezirks ab, einer Ansammlung von flachen Steinhäusern, Katen und kleinen Holzhäusern, zwischen denen sich oft unbefestigte Wege in ein Niemandsland von Durchgängen, winzigen Bächen und Lehmhaufen schlängelten. Hier hatte „Xangsane“ offensichtlich weniger Widerstand gefunden, war mit voller Wucht über die nackte, schutzlose Ansiedlung hergefallen. Kaum eine Bretter-Behausung hatte das Inferno schadlos überstanden; ihre Wände waren von den Böen niedergewalzt, von Sturzbächen weggeschwemmt, ihre Bedeckungen abgehoben, das Inventar zerstreut worden. Die Bewohner der festen Bauten mussten sich zumeist nur mit dem Verlust ihrer Dächer abfinden.
Die Mehrzahl der hier lebenden Filipinos kannte allerdings diese Ausnahmesituation, die wenigstens jedes zweite Jahr ihr ohnehin kärgliches Dasein in zusätzliche Schwierigkeiten brachte. Trupps von Bewohnern suchten immer noch das Gelände ab, klaubten die am besten erhaltenen Holzbretter aus den Trümmern, schichteten sie zu Stapeln, andere schleppten Wellblechquadrate zu den größeren Wegkreuzungen, Kalk und Lehm wurden angerührt, neue Wände hoch gezogen; es wurde genagelt, geschraubt, Kinder sammelten die Habseligkeiten ihrer Familien in Papiersäcken ein, wendeten feuchte Matratzen in der Sonne, Frauen hockten vor provisorischen Feuerstellen und kochten für ihre Familie und die ihrer Nachbarn. Am Rande des Viertels luden ein paar Soldaten Hilfsgüter der Regierung und kirchlicher Organisationen von schweren Lastern.
Eine kleine Gruppe alter Männer sah ihnen wortlos zu; hin und wieder legte einer von ihnen den Kopf in den Nacken und blickte zum Horizont im Osten, aus dem langsam der Erdschatten hervor wuchs, schwarzblau mit einem rosafarbenen Saum, der die Nacht vom Dunkelblau des Tages trennte. Ob sie wussten, dass bereits einer neuer Tropensturm auf dem Weg zu ihnen war?
Fragen wollte ich nicht.
*
900 Kilometer entfernt, südöstlich der philippinischen Hauptinsel Luzon, und noch unsichtbar für die Menschen in Manila, pflügte der neue Wirbel „Bebinca“ die Wasser der Philippinen-See. Mit jeder Stunde schob er sich 28 Kilometer näher an die Metropole heran. Seine im Kreis rasenden Böen überschritten bereits die magische Sturm-Marke von über 100 Stundenkilometern.
*
Lobster, Philippinen, nördlich der Insel Samar,
1. November, später Nachmittag
Alle Fangkäfige waren besetzt; einige mit schweren, fleischigen Hummern, die anständig Geld bringen würden.
Die Arbeit unter Wasser erledigte Matahino, der jüngste der drei Fischer. Ein um das andere Mal wand er sich einen knotigen bunten Strick um die Hüften, tauchte zum Seeboden hinab und knüpfte das Seil an die Ösen der Falle. Vom Katamaran aus wuchtete Maha die eisernen Kästen an Bord, während der Graubärtige am gegenüberliegenden Bootsrand das Fahrzeug mit seinem Gewicht austarierte.
Die aus Südost einlaufende Dünung überlagerte jetzt die Windsee; ihre ölig glatten, lang gezogenen Wellen verdeckten zunehmend das ferne Ufer der kleinen Inselgruppe.
„Der Sand unten wandert bereits“, berichtete Matahino, nachdem er die vierte Falle angebunden hatte.
Maha nahm sich einen Augenblick Zeit und prüfte Wind und Wellengang. Zwei Meter, schätzte er, lagen zwischen dem Tal und dem Kamm einer jeden Welle. Nur, wenn der starke Nordost-Wind von Zeit zu Zeit in einer stürmischen Böe auffrischte, glättete er für ein, zwei Minuten die gegenläufige Dünung des heranrückenden Taifuns.
In zwei Stunden oder weniger würden wohl die beiden restlichen Käfige unter meterhohem Sand nicht mehr aufzufinden sein. Bei ruhigen Wetter beließ man gewöhnlich alle Fallen an ihrem Platz, säuberte sie und wählte höchstens einen günstigeren Standort. Aber bei diesem Wetter ... Andererseits – wie sollte er sämtliche schwere Kästen und den Fang selbst an Bord unterbringen?
Maha beschloss, die Leute an Land um Hilfe zu bitten; eine Leuchtrakete war das verabredete Signal; zwei hätten schon Gefahr bedeutet, drei ein SOS. Er schickte eine rot-gelbe Leuchtkugel auf den Weg.
„Wir holen auch die verbleibenden Käfige hoch.“
Das Boot drehte bei und richtete seine Bugspitze schräg gegen die Schaumkämme der Windsee; es kam nur noch im Schritttempo voran. Immer häufiger schlugen backbords die Brecher der aufsteilenden Dünung gegen das Heck, drückten es in die Höhe und zur Seite, sodass das zwei Meter lange Gestänge der Motorwelle schrill heulend in die Luft ragte. Von der Verkleidung des Motorblocks stiegen heiße Dämpfe in die Luft. Maha gab auf.
Der Beobachter auf dem Stützpunkt von Batag registrierte jetzt den Abschuss zweier Signalraketen; sie waren im schräg einfallenden Licht der untergehenden Sonne kaum zu erkennen. Nur die schwarzen Rauchwölkchen brachten Gewissheit. Dem auslaufenden Hilfsboot der Kooperative schloss sich ein Polizeiboot der Großinsel Samar an.
Eine Stunde später waren die Lobsterkäfige auf dem Hilfsboot verstaut. Der Katamaran der drei Fischer wurde vom Polizeiboot in den Schlepp genommen; er hatte während der Bergung der Ladung eine seiner Gleitkufen verloren. Die See ging hoch. Wie kleine Lichtfontänen tauchten die Positionslichter der Boote in der hereinbrechenden Dunkelheit über den Scheiteln der Wellen auf.
Auf halbem Weg zur Anlegestelle Batag wurde das Polizeiboot über Funk angewiesen, die kleine Flottille direkt zur Bucht von Cartaman an der Nordspitze von Samar zu geleiten. Auf dem Eiland Batag hatte die Evakuierung des Fischereistützpunktes durch Marineeinheiten begonnen.
Der lokale Radiosender von Samar warnte vor „Bebinca“.
Am Morgen darauf, es war der 2. November, wurden zahlreiche Uferstraßen im Norden und Osten auf Samar von acht Meter hohen Wellen überschwemmt.
*
Manila
Von Ausflügen...
Aus: Tagebuch-Notizen, 2. November
Mittagszeit
Der Morgen vor dem neuen Taifun hatte wolkig begonnen; über der Laguna de Bay verharrte seit Stunden ein lokales Gewitter; seine Donnergeräusche flossen zu einem fernen Brummen zusammen, das an die fortwährenden Starts von Flugzeugen erinnerte. Als die Sonne aufging, färbten sich seine Wolkentürme tiefrot und ähnelten mit ihren Grotten und Hängen einem kunstfertig kolorierten Hologramm. Erst gegen neun Uhr hatte die Tropensonne die Feuchte der Wolkenmasse aufgesogen und war Herrin über einen nahezu freien Himmel geworden; eine Stunde später zeigte das Thermometer im Schatten des Hoteleingangs bereits 37 Grad Celsius.
Jetzt, um die Mittagszeit, riecht es selbst im Hotelzimmer säuerlich – Ozon. Millionen Autos in der Stadt, Abgase ungefiltert – kein Wunder, dass sich selbst nahe Häuserzeilen hinter einem weiß-grauen Schleier aufzulösen scheinen. Beinahe wünschte ich, der Taifun möge sich beeilen. Aber es ist noch nichts von ihm zu bemerken; die kaum erkennbaren kleinen Wolkenballen im Süden vielleicht? Möglich. Das kleine Barometer in meiner Uhr zeigt allerdings noch keine beunruhigende Reaktion des Luftdrucks an. Wie lange noch? Reicht die Zeit für einen Ausflug in die Hügelwelt rund um Manila?
12.30 Uhr Ortszeit
Das Fernsehen verbreitet an der Spitze seiner Nachrichten eine Warnung des philippinischen Wetterdienstes „Pagasa“ vor dem neuen Taifun „Bebinca“. Dem schnellen Redefluss des Moderators kann ich nur Bruchstücke an Information entnehmen; erst die angebotene Verlaufskurve enthält ein paar sichere Anhaltspunkte. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist mit dem Zentrum des Sturms erst um Mitternacht zu rechnen, also in 12 Stunden.
Ich beschließe, das immer noch einladend beständige Wetter für einen Trip zum Taal, dem Hausvulkan Manilas, zu nutzen. Die Entfernung ist bescheiden, das Verkehrsnetz ausreichend und die Route mir aus früheren Besuchen geläufig.
13.00 Uhr Ortszeit
Auf dem Weg zur nächsten Station der Metro-Rail – einer Art S-Bahn auf hohen Betonpfeilern, die viele der größeren Stadtbezirke verbindet – sehe ich bei meinem philippinischen Freund Juan vorbei.
Unsere Bekanntschaft begann vor vielen Jahren, als ich das erste Mal Manila besuchte und der für die Hauptstadt avisierte Taifun kurz vor der Küste beidrehte und sinnfällig das Weite suchte. Juan tauchte mit seiner Calesa, einer zweirädrigen Pferdedroschke, die vornehmlich Touristen aufgriff, just in dem Augenblick auf, als ich mich vom nunmehr nichtssagenden Himmelsanblick über der Manila-Bay losriss und meinen winzigen Angelhocker zusammenfaltete.
„Lust auf eine Fahrt?“, erkundigte er sich; „der erste Kilometer ist frei, nur für dich.“
Abgesehen von der anziehenden Freundlichkeit der meisten Filipinos, sprach er vor allem ein vorzügliches Englisch, das ich – im Gegensatz zum üblichen Fast-Amerikanisch auf Luzon – einigermaßen verstand. Um ihm die Freude zu bereiten, mich finanziell hereinzulegen, stieg ich in seine Droschke.
„Mädchen?“, fragte er, „größere oder ganz kleine? Ich bring dich hin, ich kenne alle; sehr sauber, sehr adrett, kein AIDS, machen alles, was du willst ...“
„Nein“, sagte ich.
Er hatte mich ratlos angesehen. „Und warum sitzt du dann auf einem Klapphocker an der Bay?“
„Ich habe auf den Taifun gewartet.“
„Auf den Taifun? Ein Taifun ist schrecklich; er macht arm. Wenn man überlebt. Jedenfalls für Leute wie mich. Wo kommst du her?“
„Aus Deutschland.“
„Und warum wolltest du den Taifun anschauen? Hast du zu Hause Ärger oder Langeweile?“
„Überhaupt nicht“, ich fand Vergnügen an dem Dialog, „es gehört zu meinem Beruf, mich um Taifune zu kümmern, zu beobachten, wie sie sich durch Wolken, Wind und“, ich zögerte, „Luftdruck bemerkbar machen, wohin sie ziehen, weshalb sie überhaupt entstehen, woher ihre Stärke kommt ... na, und vieles mehr.“
„Und deshalb hast du das viele Geld ausgegeben, bist um die halbe Welt geflogen? Und unsere ...“, er hatte einen Moment lang überlegt, „und unsere Regierung bezahlt dich?“
„Vielleicht würde sie das tun; aber es ist nicht so. Sie zahlt keinen Cent an mich.“
„Wenn das so ist ...“, er unterbrach sich erneut.
„Es gibt viele wie mich“, sagte ich rasch, „überall auf der Welt, in Instituten, Wirbelsturm-Centern, Satellitenstationen. Je mehr wir wissen, um so eher können Leute gewarnt werden, es gibt weniger Verletzte, weniger Tote; Häuser können viel besser geschützt werden, wenn nur genügend Zeit zur Verfügung steht.“
„So?“ Er schüttelte den Kopf. „Mag ja sein.“ Nach einer Pause: „Bei euch in Deutschland gibt es keine Taifune? Und der, den du erwartet hast, ist nicht gekommen, du bist umsonst hier?“
Ich hatte die Schultern gezuckt. „So ist es.“
Ein paar Tage später hatte mir Juan seine Familie vorgestellt.
Ich brauche heute einige Minuten, um das Haus wieder aufzufinden; zwei Jahre sind für relativ „mobile“ Siedlungen im Westen Manilas ein beträchtlicher Zeitabschnitt; nicht zuletzt der Taifune wegen, die in einer einzigen Nacht die gesamte Struktur durcheinanderwirbeln können. Aber Juans Haus ist aus Stein erbaut; das Calesa-Geschäft, wenn man nur listig genug damit umging, warf ein wenig Geld für einen bescheidenen Wohlstand ab. Für philippinische Verhältnisse.
Wie erwartet, hat Juan Pferd und Kutsche offensichtlich bei einem Bekannten untergebracht und kümmert sich im Angesicht des nahenden Taifuns um die Achilles-Ferse seines Hauses, das Dach. Die schweren, waagerecht an das Fundament geschraubten Blechplatten leisteten zwar auch gefährlichen Drehern eines Sturms Widerstand, doch wenn sich auch nur eine der Hauswände verkantete, weil der Boden unter dem Gebäude vom Starkregen in Brei verwandelt wurde, brachen sogar massive Schrauben und konnten derartige Bleche in freie, flugfähige und vor allem messerscharfe Ungeheuer verwandeln. Es gibt genügend vertrauenswürdige Belege dafür, dass Menschen von ihnen enthauptet wurden.
„Du bist´s, tatsächlich!“
Juan ist sichtlich überrascht, hat aber eigentlich keine Zeit.
„Gehst wohl wieder schwanger mit Unglück und gebärest Mühsal. Kommt dein Taifun diesmal wirklich an?“
Juan sitzt rittlings auf einem Querbalken, der einen halben Meter aus der Dachkonstruktion ragt und versucht, einen zentnerschweren alten LKW-Reifen über die Bleche zu schieben. In seinen Augen musste ich ihm, dem gläubigen Katholiken, wie der Mann aus dem Lande Uz, Hiob, vorkommen.
„Scheint so; ich bin mir fast sicher.“
Juan betrachtet sein Dach, auf dem er bereits fünf der massiven Reifen verteilt hat.
„Der Sturm letzte Woche hat mich zwei Bleche gekostet, einfach weg. Vielleicht hält´s jetzt besser.“
„Leg noch zwei oder drei auf die Westseite, zur Bay hin“, rate ich ihm. „Morgen Abend dreht der Wind. Wenn du glaubst, das Schlimmste hinter dir zu haben, springt er um, und die Böen kommen von See.“
„Woher willst du das schon wieder wissen?“
„Sein Zentrum ist dann wieder über dem warmen Wasser, und das macht ihn stärker als über Land.“
„Noch drei Reifen ... Ob der das aushält?“
Zweifelnd blickt mein Freund auf den gebrechlich scheinenden Ast eines Mangobaums neben dem Haus, in den er eine Umlenkrolle für den Seilzug eingeschraubt hat.
„Wird schon gehen!“
Um ihn bei Laune zu halten, ziehe ich eine Schlaufe durch den nächsten Reifen und zerre das Monstrum in die Höhe. Das Seil schwingt beängstigend weit aus, doch Juan hat einen alten Fleischerhaken aufgetrieben und bugsiert das Gummigeschoss sicher auf das Blech. Der Ast ächzt und schnellt wieder in seine natürliche Lage zurück. Nach dem dritten Reifen bin ich schweißgebadet.
„Wir brauchen jetzt einen basi“, bemerkt Juan und schnalzt in Vorfreude mit der Zunge.
„Bloß nicht; bleib' oben. Wir erledigen das nach dem Taifun, okay?“
Selbst ein einziger Schluck dieses hochprozentigen Zuckerrohr-Destillats hätte mich für den Rest des Tages die Beherrschung gekostet.
„Okay, okay.“
Juan schaut missmutig seinem älteren Sohn entgegen, der vier große Sperrholzplatten an der Hauswand absetzt, riesig im Vergleich zur schmächtigen Figur des Neunjährigen. Am Hals baumelt ihm ein kleiner Plastikeimer mit Schrauben und Nägeln, ebenfalls aus dem Supermarkt. Der Junge musste wenigstens eine Stunde unterwegs gewesen sein.
„Hol dir ein Wasser, Salvador, und bring den Tacker mit. Und den Dreher.“
Immerhin schien das Droschken-Geschäft genügend Piso, oder Peso, wie alle Welt hier die Währung nannte, abzuwerfen, um sich den Luxus vernagelter Fenster während eines Taifuns leisten zu können. Ich winke meinem Freund einen Abschiedsgruß zu. Er breitet die Arme aus.
„Und komm' wieder vorbei, wenn der Zauber hier zu Ende ist. Vergiss es nicht! Wir feiern.“
Bei diesen Worten hellt sich Juans Miene wieder auf.
„Hei“, ruft er seinem Sohn hinterher, „bring' eine Flasche Bier aus dem Wassereimer mit.“
- Uhr Ortszeit
Ich hatte den Eindruck, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung der 10-Millionenstadt Metro-Manila an diesem Mittag vor dem Taifun unterwegs war, um sich mit dem Nötigsten für die dunklen Stunden mit „Bebinca“ einzudecken: Kerzen, Sturmlaternen, Batterien, Benzin, Wasserkanister, Brot und Konserven, auf Rädern, Karren, in Säcken und Taschen fortgeschafft ... Schlechte Karten hatte, wer seine Einkäufe mit dem Auto erledigen wollte; auf den Straßen war der ohnehin von Staus geprägte chaotische Verkehr vollends zum Erliegen gekommen. Neben mir, auf dem Weg zur Rail-Station, war ich einigen ineinander verkeilten Blechhaufen begegnet, Autoruinen, deren Besitzer versucht hatten, trotz der offensichtlichen Unmöglichkeit der Fortbewegung dem Pflaster doch noch ein paar Meter abzugewinnen.
Natürlich war auch die Stadtbahn überfüllt, doch es gab – welch ein Wunder – keinen Stromausfall, und ich erreichte die Station Edsa im Süden Manilas ohne Zwischenfälle. Von hier aus waren es nur ein paar Meter bis zum Terminal der Batangas-Buslinie.
1
Angekommen stelle ich fest: es scheint mein Glückstag zu werden. Der Bus nach Nasugbu via Tagaytay am Taal-See steht noch an seinem Platz, der Fahrer kratzt gerade die Reste seines Mittagessens in eine Plastiktüte, zählt die Fahrgäste, nickt mir freundlich zu und startet temperamentvoll durch. Das Vehikel ächzt.
Zwischen zwei Narra-Bäumen wird für Sekunden der Horizont des Südhimmels sichtbar: Streifen von Schäfchenwolken steigen aus der Tiefe.
Geschöpfe Bebincas.
Kurz vor 15 Uhr Ortszeit
Der Bus hat die südlich Manilas gelegene Kleinstadt Silang passiert; linkerhand wölben sich die ersten Hügel auf, Ausläufer eines rund tausend Meter hohen Mittelgebirges, das die Nordseite des Taal-Vulkans umgibt. Die Landschaft hat etwas von den Zauberbergen im Märchen; die Höhen scheinen noch fern, doch nimmt man sich Zeit und lässt sie nicht aus den Augen, rücken sie scheinbar mit einem kühnen Sprung in die Nähe des neugierigen Betrachters; Höhlen und Grate schälen sich aus dem Dunst, hellgrünes Buschwerk wandert über ihre Hänge, Inseln dichten Waldes umrunden im Wasser glitzernde Reisfelder – eine Einladung der Natur.
Sie wird auch diesmal so freundlich vorgetragen, wie ich sie seit meinem letzten Besuch – vor Jahren – in Erinnerung hatte; damals, als ein Taifun zum Windspiel verkam und sich in den Weiten des Chinesischen Meeres verlor, ohne die Natur der Inselwelt anzutasten.
Während sich der Bus die erste bedeutende Steigung hinaufquält, bricht das bis dahin grelle Licht der Tropensonne plötzlich zusammen. Schatten wabern die Hänge entlang, zwischen den Gipfeln beginnt die Luft zu rauchen. Wenige Minuten später bedeckt unansehnlich graues Gewölk die Täler und Sattel; die Wolkenkante des ersten, noch harmlosen Spiralarms des ausgreifenden Taifuns „Bebinca“ nimmt Besitz vom Paradies.
Tagaytay
Hier in der Nähe beginnt der Fußweg zum Talkessel des Vulkans, und ich mache den Fahrer mit meiner Absicht vertraut, seinen schönen Bus zu verlassen. Er bremst vor einem überraschend komfortablen Wartehäuschen für Taal-Touristen, wünscht mir spöttisch blinzelnd frohe Stunden am Vulkan, beugt sich nach vorn, um durch die Windschutzscheibe einen Blick auf das düstere Gewölk zu erhaschen und beschleunigt das Vehikel, als sei ihm „Bebinca“ bereits dicht auf den Fersen. Ich schaue auf den Luftdruck-Messer an meiner Uhr: der Wert ist nur geringfügig tiefer als vor einer Stunde. Ich habe also nichts zu befürchten. Vorsichtshalber merke ich mir die drei nächsten Termine am Busfahrplan nach Manila.
Der Weg zum Tagaytay-Ridge, von dem aus man gewöhnlich einen unverstellten Blick auf die Insel mit dem Vulkan in ihrer Mitte hat, ist gut ausgebaut. Touristen und Wochenendurlauber Manilas nutzen ihn, hinter Strauchwerk und niedrigen Palmen verborgen haben sich vermögende Hauptstädter angesiedelt. Wenige Kilometer weiter schließlich, am Rand des steilen Felsabbruchs zum Taalsee-Kessel, gabelt sich die Straße. Ich lehne mich an das wacklige Geländer, voller Erwartung einer prächtigen Aussicht. Und bin enttäuscht. Nichts. Nichts ist dort, wo der See und der Vulkan ein paar hundert Meter unter mir liegen müssten, auszumachen. Nichts, nur – natürlich – dicker pappiger Nebel, der unter dem Druck des mäßigen Windes in Wellen zu schunkeln scheint. Hin und wieder bricht aus dem Weißgrau eine Art Protuberanz in die Höhe – eine Rauch-Eruption des Vulkans ... oder ein bescheidener Wolkenschlot in der zunehmend labileren Atmosphäre vor „Bebinca“? Ich bin mir nicht sicher.
Erst jetzt bemerke ich, dass der bisher stetig aus Nord wehende Wind unruhiger geworden ist und mit jedem Stoß weiter nach Nordost eindreht. Trotz des bedeckten Himmels scheint es noch heißer geworden zu sein, und der Luftdruck hat sich wohl endgültig für einen katastrophalen Sinkflug entschieden. Ein schlechtes Zeichen.
Unschlüssig schlendere ich am Hang entlang, immer in der Hoffnung, vielleicht doch mit einem Blick auf den legendären Vulkan belohnt zu werden. Vergebens. Aus dem Dunst über dem Gehweg löst sich dagegen die mir noch vertraute Silhouette eines schlossähnlichen Gehöfts; die Liegewiese davor – wie ein Amphitheater zum üblicherweise rauchenden Taal geneigt – ein geschätztes Ziel der Hauptstädter, wenn sie der beklemmenden Luft Manilas entfliehen. Bei meinem letzten Besuch ging es hier zu wie in einem öffentlichen Strandbad zur Hochsommerzeit, laut, die Körper dicht an dicht gepackt, das Geschrei von Kindern. Heute haben nur wenige Familien die Ausfahrt gewagt. Vom seltsam farblosen Bild der Ausflügler geht eine bleierne Starre aus, selbst die Stimmen scheinen eingeschmolzen.
Noch ein Versuch, wenigstens den oberen Zipfel des Kraters in der Tiefe auszumachen ... Erfolglos. Die Sicht wird immer schlechter; Fetzen des Nebelschleiers klettern über den Felssturz. Ein feiner Sprühregen treibt heran.
Es ist Zeit, die Rückfahrt anzutreten.
Als die Straßengabelung wieder in Sicht kommt, rast eine erste heftige Böe durch die Wipfel der Palmen, eine zweite wirft mich fast von der Straße; ich beschleunige den Schritt; doch die nächsten Stöße bleiben aus, verlieren sich irgendwo in den schwarzgrauen Wolken.
Nachtrag Tagebuch, 2. November, Früher Abend
Hotel
Wie so oft im Umfeld angedrohter Wetterkatastrophen nehmen die Menschen das dämmernde Chaos schon einmal vorweg. Mindesten fünfzig leichtfertige Ausflügler hatten nach dem Aufkommen der ersten Sprühregenschwaden die Flucht ergriffen und lauerten nun an der Haltestelle von Tagaytay auf den Bus nach Manila. Statt des feinen Getröpfels schickte „Bebinca“ inzwischen kurze schwere Regenschauer in die Bergwelt; der Wind hatte wieder beängstigend zugenommen; die Erwachsenen versteckten ihre kleinen Kinder unter den eigenen Regenumhängen, versuchten geduldig, sie zu beruhigen. Doch der Wind riss ihnen die Worte von den Lippen; die Botschaften kamen nicht an.
Als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, war das wacklige Bus-Vehikel auf die Minute genau zur verabredeten Fahrplan-Zeit erschienen; aus den weit geöffneten Fenstern und den drei Türen stob mit dem Wind der Geruch schwitzender Körper heran. Nach herkömmlichen Maßstäben war der Bus überfüllt. Aus Erfahrung wusste ich jedoch, dass niemand an der Haltestelle zurückgelassen würde. Der Schaffner hing auf dem Querbrett der hinteren Tür, zeigte mit ausholenden Gesten auf seine Uhr und trieb die durchnässten Kunden an, sich zügig ins Innere zu begeben. Niemand sollte an seinem Willen zweifeln, jedweden Fahrgast zum versprochenen Ziel zu befördern.
Zurück blickend würde ich diese Fahrt als grauenhaft einstufen. Jeder Sitzplatz war doppelt belegt; zwischen den jeweiligen Knien der Sitzenden und der geneigten Vorderlehne bog sich ein weiterer Körper um die Schräge; der schmale Mittelgang ließ die Dreier-Reihe dampfender Passagiere schon aus geometrischen Gründen eigentlich gar nicht zu ... Die Filipinos waren allerdings guter Dinge; nur in sehr scharf genommenen Kurven hörte ich hier und da ein leisen „Oh“.
Trotz des stürmischen Winds, der sich dem Bus frontal entgegen stemmte und in alle weit geöffneten hohen Fenster gleichzeitig fuhr, wollte sich die heiße und schwüle Luft nicht aus dem Inneren verabschieden. Der Schweiß verklebte Hemden und Blusen, Kondenswasser tropfte von der Decke. Sicherlich trug der stürzende Luftdruck dazu bei, dass auch das Atmen immer schwerer fiel. Im hinteren Teil des Busses klapperte derweil der Schaffner mit seiner altertümlichen Geld-Blechdose. Da ihm der Weg über den Boden des Gefährts bei der gegebenen Packung der Kunden versagt blieb, war er auf die eisernen Bügel der Sitzlehnen gestiegen, verankerte sich jeweils Schritt für Schritt in den ledernen Halteschlaufen, die über dem Mittelgang herabhingen, zog sich an den Netzablagen vorwärts oder fand die notwendige Ruhe für sein Geschäft auf den Schultern sitzender männlicher Fahrgäste. Einige Passagiere, die ihre Kleidung nicht den Turnübungen des Schaffners aussetzen mochten, veranstalteten Sammlungen, und reichten das Fahrgeld über andere Reisende weiter. Als der Bus kurz vor Manila in einer unübersichtlichen Straßenschleife abrupt bremste, da ein eben herabgestürztes Gemenge aus Sand und Geröll die Fahrbahn einengte, erschien der Oberkörper des Schaffners, vom Schwung und Beharrungsvermögen seines Körpers getragen, für einige Momente außerhalb der Fenster ...
*
Die Metro-Rayl hatte ihren Betrieb noch nicht eingestellt. Allerdings waren ihre Waggons jetzt gähnend leer; der Wind heulte über dem Dach, fuhr pfeifend durch das rollende Untergestell, die Konstruktion schwankte hin und wieder bedrohlich, und die gesammelten Striemen dünnen Regens schossen ruckweise über das Fensterglas.
Die grau verschleierten Behausungen dahinter hatten das Volk Manilas aufgesogen.
Als ich an der Padre Gil-Station das Bahngelände verließ, blitzte dicht über dem Horizont im Westen, vielleicht 200 Kilometer entfernt, noch einmal ein grell-weißer Streifen auf: die untergehende Sonne, eingeklemmt zwischen der vorderen Wolkenkante des Taifuns und der abschüssigen Rundung der Erdkugel, schien einen vorerst letzten Blick auf Kulissen und Darsteller des heraufdämmernden Dramas werfen zu wollen. Dann erlosch das Licht. Jedes Teil meiner durchnässten Kleidung schien sich plötzlich enger um mich zu legen, mir den Atem zu nehmen; die wenigen altertümlichen Straßenlaternen glimmten nur noch. Ich lehnte mich an eine Hauswand, zog Hemd und Leinenhose aus und stolperte in Boxershorts die Adriatico Street entlang, bis ich die Padre Faura und mein Hotel erreichte. Nur eine Stunde Schlaf, nur eine einzige! Als ich einschlief, produzierte mein Gehirn wundersame Bilder knöcheltiefen Schneematschs. Vergnügt watete ich in den Traum.
Wettfahrt
Insel Samar, Nähe Tacloban
1. November, 6 Uhr früh Ortszeit
Aus dem persönlichen Logbuch des Kapitäns Kuoto
Zum zweiten Mal in Tacloban Fracht gelöscht, neue Container an Bord; bereits 5 Uhr Fahrt aufgenommen. Sonnenaufgang verfolgt, aber nur spärliche Indizien für „Bebinca“ ausgemacht, insbesondere rot-gelbe Streifenwolken in großer Höhe über der Kimm, rechts neben der Sonne. Luftdruck steigt etwas. Bisher kaum Gegenwind. Vielleicht nur eine ungefährliche Störung?
Hoffentlich. Über Land sind aus dem Nichts plötzlich isolierte Quellwolken geschossen. Gefährliche Vorzeichen?
Casogoran Bay
- Uhr Ortszeit
Golf von Leyte verlassen, freies Wasser, längstes Wegstück bis zur imaginären Taifun-Kreuzung vor uns. Strikten Nordkurs gesetzt; Ostküste Samars entlang. Luftdruck hat seinen Höchststand verlassen, fällt leicht, aber stetig. Über See jetzt ebenfalls Wolkenbänke.
Warn-Center konsultiert. „Bebinca“ soll Status „Tropensturm“ erreicht haben; müsste sich neben uns, etwa auf gleicher Breite befinden, allerdings rund 300 Kilometer entfernt im Osten. Zieht schräg auf unseren gesetzten Kurs zu, hat also den längeren Weg. Wenn der werdende Taifun sein Tempo beibehält, sollte es spielend gelingen, die Kreuzung vor der Ankunft seines Zentrums zu passieren und durchzuschlüpfen; wenn auch bei rauer See.
Freie See, in Sichtweite der Insel Samar
13 Uhr Ortszeit
Der Sturm im Südosten setzt uns nach; Entfernung schätzungsweise 250 Kilometer. Sein Wolkenschirm hat bereits den gesamten Himmel überzogen; noch sind es dünne graue Wolken; Sonne wie hinter Milchglas. Der Zeiger am Barometer ist schneller als bisher gesunken. Seit zehn Minuten behindern scharfe Windböen die Fortbewegung unseres Schiffs. Die Temperatur liegt weiterhin bei 30 Grad.
Bin auf dem Hängegang zwischen den Containern zum Vorschiff geklettert, um Wellengang aus der Nähe zu prüfen. Ungünstiger Eindruck. Die schaumige Windsee aus Nordost reicht kaum noch in die Tiefe; von dort steigt die Dünung „Bebincas“ auf. Offensichtlich hat der Wirbel das Stadium eines einfachen Tropensturms längst überschritten.
*
Freie See, östlich von Samar, 1. November, 13.30 Uhr Ortszeit
Lagebesprechung
„Wir haben ein Problem“, sagte Kapitän Tuoko und trat an den Wand-Bildschirm, der die Route des Schiffes nachzeichnete. „Laut Navigationssatellit hat uns die Dünung näher an die Küste gedrängt, als uns lieb sein kann. Über Untiefen und Klippen liegen keine Informationen vor. Hinzu kommt, Rumpf und Container weisen unkontrollierte Resonanzen auf; ich war Vorschiffs, die Schwingungen sind deutlich fühlbar, sie könnten sich aufschaukeln, wenn wir die Fahrtgeschwindigkeit nicht verändern.“
„Langsamer geht nicht“, bemerkte der Erste, „dann holt uns der Sturm auf jeden Fall ein. Also schneller. Geht das?“
Der Maschineningenieur nickte. „Es muss gehen. Ich glaube nicht, dass wir bei der Überholung des Motors etwas übersehen haben.“
„Das wäre geklärt.“ Tuoko war zufrieden. „Bliebe der Abtrieb zur Küste. Wir könnten kreuzen, in kleinen Schritten, und den Abstand etwa halten. Oder einen langen Ausfall weg von der Küste versuchen, bis die erneute Annäherung den kritischen Punkt wieder erreicht hat.“
Es dauerte einige Minuten, während der Zweite Offizier den Rechner programmierte.
„Das Gegenkreuzen in kleinen Schritten scheint günstiger zu sein“, sagte er schließlich zögernd. „Der Sturm wird noch zunehmen und wir gerieten zu nah an sein Zentrum. Allerdings ist es die gefährlichere Variante, so nah an der Küste zu manövrieren; die Sicht ist schlecht und wird sich noch verringern. Leider wird sich unsere Fahrtzeit – wie wir uns auch entscheiden – in dieser Phase ungefähr verdoppeln.“
In diesem Augenblick traf eine heftige Windböe die rechte Seite des „Drachen“, das Tageslicht verblasste und schwerer Schauerregen senkte sich über das Schiff. Die Container rieben sich in ihren Halterungen, Metall kreischte.
„Windstärke 11, mindestens. Orkan“, murmelte der Erste.
„Offensichtlich keine Alternative greifbar. Kreuzen wir also in kleinen Schritten, in der Götter Namen“, schloss der Kapitän die Besprechung. “Und überprüfen Sie alle Befestigungen der Fracht.“
Tuoko überließ die Brücke dem Ersten und kletterte zum Deck hinunter; er hatte plötzlich das Bedürfnis, das Gesicht, seinen ganzen Körper dem Sturm, den Regenböen und dem Echo der auf den Schiffsrumpf aufschlagenden Wellen auszusetzen. Hier unten, zwischen den Containern, den Seilen, an die er sich klammerte, schien ihm seine Macht über den wehrhaften Frachter aus den Händen zu gleiten; sein Kopf gaukelte ihm die unermessliche Tiefe des Meeres jenseits der dünnen Stahlhaut des Schiffsbodens vor, ungreifbar der Wind, der Regen, die Flut; niemand, an den man sich anlehnen konnte, der ihm die Verantwortung abnahm. Um sich herum nur das Nichts im grauen Licht des heraneilenden Taifuns. Der Kapitän zuckte zusammen, als hinter ihm eine Außentür scheppernd ins Schloss fiel. Niemand würde ihm und seinen Leuten jetzt helfen; er hatte sie auf diesen Kurs, in dieses Inferno geschickt. Er allein. Kein fremdes Schiff, kein Rettungspilot konnte noch etwas ausrichten. Wo ist das Wasser, wo beginnt der Himmel? Wir schweben, dachte Tuoko.
Er spürte, wie der „Drache“ plötzlich ruckte, wie das Heck des Schiffes herum schwang und den Bug vom unsichtbaren Land weg auf die freie See richtete; sofort verließ der Frachter seine Schräglage und bäumte sich mit dem Vorschiff auf, als führen jetzt alle Wellen unter den Kopf des „Drachen“.
'Er macht das sehr geschickt', murmelte Tuoko und versuchte vergeblich, durch die wirbelnden Gischtflocken einen Blick auf die Computer-Station des Steuermanns auf der Brücke zu werfen. Die Fahrt erschien ihm mit einem Mal sehr viel weniger abenteuerlich zu verlaufen. Was sollte uns schon passieren, dachte er; wir wissen, was „Bebinca“ unternimmt, besitzen ein zuverlässiges Schiff und erfahrene Seeleute.
„Wir haben mit dem Kreuzen begonnen, Herr Kapitän“.
Tuoko hatte nicht bemerkt, dass inzwischen der Zweite Offizier zu ihm getreten war.
„Ich weiß. Danke.“
*
Aus dem Reisebericht des Ersten Offiziers:
Die letzten Stunden (Bearbeiter: Lokale Presse)
Am frühen Abend des 1. November geriet der „Kleine Drache“ in zunehmend schwere See; unser Feind, „Bebinca“, hatte ohne Vorwarnung einen raschen Schwenk nach Westen, also in Richtung unseres Kurses, vollführt und schien auf irrwitzige Weise seine Anstrengungen zu verdoppeln, den Frachter doch noch einzuholen, bevor er über den angenommenen Kreuzungspunkt nach Norden entweichen konnte. Auch schien der Wirbel sein Reisetempo zu verdoppeln, wobei er inzwischen lt. Hawaii-Center Spitzenböen von mehr als 120 km/h produzierte.
Der Kapitän schien jetzt an vielen Orten des Schiffes gleichzeitig zu sein, ließ ständig die Tiefe loten, veranlasste den Ingenieur, die Motoren über die erlaubte Belastungsgrenze hinaus hochzufahren (was ich für bedenklich hielt), hangelte sich – mit einem Seil gesichert – an der Containerfracht entlang, um die Befestigungen zu überprüfen, und hielt mit meiner maßgeblichen Unterstützung ständige Verbindung mit dem beobachtenden Satelliten des Taifun-Centers. Fragen beantwortete er nicht mehr, was eine Zusammenarbeit mit ihm erschwerte. Als eine der – wie üblich besonders hohen – Monsterwellen den „Drachen“ in eine Schieflage von nahezu 35 Grad wuchtete, bemerkte er nur, dass uns „Bebinca“ jetzt ganz offensichtlich am Schwanz gepackt habe.
Kurs zu halten, schien immer unmöglicher zu werden. Gegen 20 Uhr erfasste eine Resonanz-Schwingung des Stahlgerippes nahezu den gesamten Rumpf und die Aufbauten. Die Zeiger der Instrumente zuckten scheinbar wahllos über die Skalen, und der Steuermann und ich verloren jede Orientierung. Hatten wir noch – zumindest andeutungsweise – den Kurs anliegen?
Einzig der Kapitän versuchte den Eindruck zu erwecken, seiner Sache sicher zu sein, und dirigierte den „Drachen“ auf einem unsichtbaren Pfad voller Gischtfetzen und Regensträhnen, die waagerecht durch die Luft schleuderten und uns – trotz der Scheinwerfer – jeden Rest von Sicht in der pechschwarzen Nacht nahmen. Nach meiner Schätzung befand sich das Sturmzentrum bald keine 100 Kilometer mehr entfernt, irgendwo neben uns, steuerbords.
Gegen 21 Uhr teilte endlich das satellitengestützte Ortungszentrum unsere ungefähre Position mit – der Kapitän hatte sich nicht geirrt; das Schiff befand sich immer noch – mit einer Abweichung zur freien See hin – ungefähr auf Kurs. Die gesamte Mannschaft bezeugte Respekt.
Hielten Ladung und Material durch, durften wir hoffen, in gut zwei Stunden den berechneten Kreuzungsbereich unserer Fahrt mit der Sturmbahn zu erreichen. Vor „Bebinca“, versteht sich.
Gegen 21.30 Uhr drang aus Richtung Mittschiff das Kreischen von Metall durch die lärmende Wand tosender Winde und Wasserwülste, als bremsten ein paar der Güterzüge, die seit Stunden über das Deck polterten, vor einem unsichtbaren Prellbock. Ich hakte mich an das Seil und kroch hinaus zu den Containern; in meterhohen Fontänen brach sich das Wasser an ihren Kanten. Der oberste Behälter hatte eines seiner Stahlbänder eingebüßt und schlingerte Zentimeter um Zentimeter zum Rand ... Erst eine halbe Stunde später gelang es drei Leuten der Besatzung, den Container mit zusätzlichen Ketten notdürftig zu fixieren.
Die Kreuzung
Aus Aufzeichnungen des Kapitäns (Bearbeiter: Lokale Presse)
- November, 22 Uhr Ortszeit
Zwei Stunden vor Mitternacht näherten wir uns dem Kreuzungspunkt; ich wusste nicht, ob ich noch die Konzentration aufbringen würde, der zunehmend irritierten Crew das Letzte abzufordern.
Gewiss, dass wir nicht all zu weit vom Kurs abgekommen waren, hatte der Mannschaft vorübergehend etwas Mut gemacht, doch würden sich Panik oder Resignation auf Dauer vermeiden lassen?
Obwohl wir mit der Schiffsenergie sparsam umgehen mussten, befahl ich, auf den letzten Meilen vor der imaginären Kreuzung alle Scheinwerfer einzuschalten; ich musste – soweit es das Wellenchaos gestattete – sehen, was mit meinem Schiff und seiner Fracht geschah. Und Licht würde die Angst mindern.
Die vor uns aufwachsenden Abhänge aus Wasser hatten inzwischen wohl Höhen von zehn oder zwölf Metern erreicht; in langen balligen Striemen schoss der Ozean an Bug und Containern empor, über seine schwarz-grüne Haut irrten die Spiegelbilder unserer Scheinwerfer. Erst an den Scheiteln der Brecher verwandelte sich das Meer in Striche weiß glimmenden Schaums, den der Orkan mit sich fortriss. Der flockige Salznebel drang durch alle Türspalte, fraß sich in die Gerätebohrungen, durchnässte selbst die Seekarten auf der Brücke. Mehr als 80 Kilometer dürfte das Wirbelzentrum nicht entfernt sein.
Als die Windregistrierung am Kommandostand ausfiel, ahnte ich, dass sich der Böenschreiber am obersten Ende des Mastes davongemacht hatte, abgebrochen oder auch nur verbogen.
Der Erste Offizier, festgebunden an der Reling, bemühte sich, mit einem Handanemometer eine Vorstellung von der herrschenden Orkanstärke zu bekommen.
140 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit!
Der „Drache“ ist nur noch schwer zu dirigieren; auch scheint der Seeboden plötzlich wieder anzusteigen. Ich befehle zügigen Kurswechsel auf die freie See, um nicht am Sockel der Insel zuletzt noch zu scheitern. Zu diesem Zeitpunkt ist es nahezu gleichgültig, welche Ideen der Taifun selbst gerade hat.
Der Frachter dreht nur widerwillig bei; ein um das andere Mal wird seine Spitze in die Höhe geschleudert, und das Heck gerät zu Teilen unter Wasser. Während die physische Gewalt des Orkans die Oberfläche des Wellenfelds immer wieder einebnet, drückt die gleiche Welle der Dünung das Heck wieder in die Höhe, und der Bug schwingt dafür zurück und schlägt wie ein Stein in das nächste sich aufbauende Wellental. Mit jedem Aufschlag scheint die Containermasse labiler zu reagieren, ruckt an den Verspannungen und Ösen.
Der Erste hat die Gefahr erkannt, nickt mir zu und weist den Steuermann an, die Wellenfront erneut schräg anzugehen; sollten die Schrauben aus dem Wasser auftauchen, wäre jedes weitere Schiffsmanöver unmöglich.
Kurz vor 23 Uhr erfasst uns erneut eine der Monsterwellen; der Aufschlag des Vorderschiffs auf die Wasseroberfläche ist gewaltig. Bevor der nächste Wasserberg jede Sicht auslöscht, höre ich den Ruf des Ersten, fassungslos deutet er auf das Vorschiff: wie in Zeitlupe dreht sich der oberste Container im Scheinwerferlicht um seine Achse, schwingt über die Kante des vorderen Großbehälters, rumpelt, das Getöse des entfesselten Wassers übertönend, und verschwindet in der See. Der „Drache“ hebt sich mit einem Ruck – und lässt sich von der tonnenschweren Last der nächsten Woge wieder ins Gleichgewicht drücken.
Schadensmeldung! Der Erste nimmt Haltung an: Verlust eines Containers. Schiffsrumpf nicht beschädigt. Fracht des Containers? „Durian“, sagt der Erste, „stinkende halb reife Früchte.“
Hätten wir abwettern sollen? Irgendwo – irgendwo? – in einer sicheren, geschützten Bucht der Insel vor Anker gehen? Der Reeder wird es so sehen. Möglicherweise.
Aber wir hatten auch Glück. Viel Glück. Viel. Der „Drache“ trägt uns noch.
Mit heftigen Böen dreht der Sturm nach Ost ein. Es ist kurz vor Mitternacht. Ich kann es kaum fassen – wir haben es geschafft.
Die „Kreuzung“ liegt hinter uns.
„Bebinca“ hat das Rennen verloren.
Im Prinzip.
***
Manila, Innenansicht eines Taifuns
Abend des 2. November
Hotel
Ein heftig schepperndes Geräusch riss mich aus dem Schlaf. Das Zimmer lag im Dunkel; es roch abgestanden nach Schweiß und Insektiziden.
Ich benötigte einige Momente, um herauszufinden, dass ich noch in Boxershorts und Sandalen quer auf einem Bett in einem Hotelzimmer nahe einem Vergnügungsviertel lag. Für wenige flüchtige Sekunden war ich versucht, mich zu fragen, was ich in dieser Absteige eigentlich verloren hatte.
Im nächsten Augenblick verwandelte eine Explosion hellblauen Lichts vor dem Fenster den Raum in ein schwarz-weißes Muster flacher geometrischer Figuren, erneut gefolgt vom stotternden Getöse eines in der Nähe einschlagenden Blitzes.
Ich schaltete die Bettleuchte ein und schob den Regler der Klimaanlage bis zum Anschlag. Der Wecker zeigte 20 Uhr.
Derartige Gewitter, erinnerte ich mich, gehörten nicht gerade zwangsläufig zum Repertoire eines erst heranrückenden Taifuns. Ich machte mich frisch, griff die Kamera und lief zum Hoteleingang hinunter, dessen Vordach ausreichenden Schutz versprach.
Offensichtlich gingen nur die beiden einsamen Einschläge auf das Konto des nahenden Sturms, irgendein Wolkenknoten in einem seiner Spiralarme. Ansonsten hielt sich auch dieses Gewitter in den üblichen Grenzen vieler Tropenschauer: spektakulär, aber ungefährlich. Hunderte dünne Blitzfäden, die von Wolke zu Wolke sprangen, beherrschten das Firmament, stoben in alle Richtungen, kringelten sich ein, erstarben plötzlich.
Ein kaum unterbrochenes Murren ferner schwacher Donner ging von den langen Glühfäden aus, wenn sie in einem der oberen Stockwerke der Wolke neu geboren wurden.
Dies alles sah überaus hübsch und possierlich aus und hörte sich – verglichen mit den oft gewalttätigen Gewittern deutscher Breiten – recht versöhnlich an. Auch der jetzt einsetzende „Regen“ entsprach der hier vorherrschenden Norm. Seine Tropfen waren derart aufgeblasen und dicht gepackt, dass sie sich gegenseitig den Weg versperrten, noch in der Luft ineinanderzufließen schienen und als nahezu fugenloser Wasserkörper jede Bodensenke minutenschnell in einen See, jede Straße in ein reißendes Gewässer verwandelten. Nur der Weitsicht der Straßenbauer Manilas war es wohl zu verdanken, dass die Passanten nicht bei jedem „gewöhnlichen“ Regenguss durch überbordende Wasser von den Bürgersteigen gespült wurden: Viele Steinkanten hatten etwa die vierfache Höhe der in Deutschland üblichen Begrenzungen.
Über die Kanalisierung der Wassermassen eines Taifuns nachzudenken, verbot sich dagegen von selbst. Die Hauptstädter lebten mit den maßlos überzogenen Überflutungen durch die Wirbel wie die Deutschen mit dem Schneematsch.
Das Gewitter dieses Abends endete so rasch, wie es aufgezogen war. Der vorübergehend abgeschlaffte Wind frischte wieder böig auf, während sich hinter den Spitzen schwarzzackigen Gewölks eine rotgelbe Mondscheibe sehen ließ. Die Idylle währte allerdings nur wenige Minuten; dann jagte von Norden ein tief liegender Dunst- und Nebelschleier heran, die Böen wurden heftiger, der Mond kippte hinter die Wolkenbank und leichter Regen setzte ein. Die Kurve des Luftdrucks, stellte ich nach dem Blick auf meine Uhr fest, wies inzwischen steil nach unten.
Die Unwetter würden also nicht mehr lange auf sich warten lassen; allerdings gedachte ich nicht, die Nacht mit „Bebinca“ in einem tristen Hotelzimmer zu verbringen. Ein deutscher Bekannter, dem ich für heute Abend – etwas eigennützig – einen Besuch in seinem strandnahen Haus versprochen hatte, ließ bereits durch den Portier bestellen, dass er mich in einer viertel Stunde mit dem Auto abholen würde.
Vor Jahren waren wir in einem indonesischen Restaurant in Berlin zufällig ins Gespräch gekommen; er hatte von seinem Arbeitgeber, einem multinationalen Konzern auf den Philippinen, vor einer Woche „Heimaturlaub“ bekommen, und sehnte sich bereits jetzt nach Manila, nach seiner Frau, einer Filipina, mit der er in einem neuen Haus gemeinsam lebte, und nach dem „anheimelnd“ warmen Wetter dieser südasiatischen Gegend.
Seit diesem Treffen hielten wir lockeren Kontakt zueinander, und als ich ihn jetzt, nach meiner Ankunft im Hotel angerufen hatte, bestand er auf einem Besuch, da er „einen Kenner der Materie und ein paar zusätzliche Hände“ gebrauchen könne, um „sein Heim festzuhalten.“ Frau und – inzwischen – zwei Kinder habe er „sicherheitshalber“ ins Landesinnere „evakuiert“.
Wenig später waren wir unterwegs zu einer kleinen Einbuchtung im Süden der Bay.
Das Häuschen passte sich den bescheidenen Dimensionen des Strandbogens an, war allerdings ziemlich massiv gebaut, wirkte klobig und vertrauenswürdig sicher, mit dicken Türen zur Bay und zur Landseite hin und mit einem hellroten Ziegeldach. Der schmale Garten reichte bis an den Roxas-Boulevard heran, auf dem zu dieser Stunde immer noch lebhafter Verkehr herrschte, obwohl die Nähe „Bebincas“ mit jeder Minute spürbarer wurde. Der stürmische Wind fiel von Landseite über den ufernahen Hain von Palmen her, ihre Wedel streckten sich hilflos flatternd dem Meer entgegen, zerrten an den starren Stämmen, Blattwerk riss sich in Bündeln los und tanzte auf die in der Ferne tosende See hinaus. Die Uferzone selbst hatte sich auffällig verbreitert, die Wasser zogen sich unter dem Zwang des Orkans vom Strand zurück.
„Was meinst du?“, fragte mein Bekannter.
„Mindestens Windstärke 11.“
„Und?“
„Die Tür zur See hin öffnen. Und festzurren. Sonst reißt dir der Innendruck das Dach weg.“
Der Hausherr nickte und verschwand im Westflügel.
Gegen 23 Uhr begannen die scharfen Ecken der Regentraufen am Haus zu pfeifen, irgendwo nebenan rumorte es, klatschende Geräusche mischten sich unter den allgemeinen Lärm.
Ich versuchte, die Herkunft der Laute zu erkunden. Endlich fand ich einen Spalt in einem der vernagelten Fenster und starrte voller Unruhe in das seltsam bewegte Dunkel.
Nichts war zu erkennen.
„Gibt's Licht in deinem Garten?“
„Warte...“
Wenig später flammte ein Scheinwerfer über der Gartentreppe auf, erfasste in der Ferne zierlich durch die Luft trudelnde Ziegel; wie Schmetterlinge stiegen sie vom Dach eines zweistöckigen Gebäudes auf; einen halben Meter über dem First vom Windkanal des Orkans erfasst, rasten sie in Richtung See davon.
„Bebinca“ hatte mit der Demontage des Nachbarhauses begonnen.
Der Besitzer erschien kurz im Türrahmen, schwenkte offensichtlich verzweifelt die Arme und sprang wieder ins Innere, als im Tumult der Winde lebendes Holz zu winseln und zu kreischen begann. Mehrere Stämme barsten unter der Gewalt einer Böe, verkeilten sich wenige Meter entfernt an der Grenze beider Grundstücke.
„Sein Haus ist solide; für anständige Schindeln fehlt das Geld“, sagte mein Gastgeber bekümmert. „Wenigstens ist ihm bis jetzt keine Palme auf den Kopf gefallen.“
Der Regen war inzwischen in wütendes Geprassel verfallen, behauptete sich im Gedränge der Stimmen, die das Haus überzogen. Rinnen und Bäche gruben sich in die Erde, fanden im aufweichenden Boden immer weniger Widerstand. Vor der geschlossenen Haustür strudelte es wie an einer Stromschnelle. Als ein Stück vom Hang nachrutschte, sprang der Pegel. Stausee vor der Türschwelle. Gurgelnd wühlte Wasser unter ihrem Holz; endlich ein Rinnsal im Haus, schmutzig, erdig, zögernd aufsteigend, in die Diele perlend, Blasen am Rand der Schwelle, quellend. Wir starrten hilflos. Bäche im Haus.
„War schon mal so“, brummte der Hausherr lakonisch. „Dahinten hopst er wieder raus.“
Er wies zum anderen Ende des Korridors, zur geöffneten Tür, an der es der Bach in kurzer Zeit zu einem ordentlichen Becken Wasser gebracht hatte, das stoßweise über den unteren Türrahmen schwappte. Wir zogen Gummistiefel an.
Eine halbe Stunde später begann das elektrische Licht zu zittern, flackerte noch minutenlang. Kurz vor Mitternacht fiel der Strom endgültig aus.
Das Geheul „Bebincas“ nahm zu; wurde allgegenwärtig, aus jeder Zimmerecke, jedem Schrank pfiff und rasselte es, Erbsen im Blechtopf, ein Dutzend kämpfender Katzen, Murmeltiere oder ähnliches, und Böen, die Anlauf nahmen und das Gehör aus dem Kopf zu saugen schienen.
„Mindestens 160 Stundenkilometer, wenn das reicht“, brüllte ich meinem Gastgeber hinterher, der ziellos durch die Räume wanderte, mit seiner Taschenlampe spielte und bei jeder dumpfen oder knackenden Antwort des Hauses auf den Winddruck des Taifuns zusammenfuhr.
Meine Gedanken verknoteten sich allmählich; es gab keinen Platz mehr in diesem Chaos, keinen stillen Ort für vernünftige Überlegungen.
Von den Decken der meisten Zimmer tropfte es inzwischen; der Orkan trieb den Regen unter die Ziegel, die Plastikabdeckung über dem Putz dürfte längst zerscheuert sein, und bald würde sich der Aufenthalt im Haus nicht mehr wesentlich von der Lotterwirtschaft des Regens vor dem Gebäude unterscheiden; von Windstärke 12 und beliebig mehr einmal abgesehen.
Wie viel würde der Bau aushalten?
Im unsteten Licht einer kleinen Dynamo-Leuchte hatte ich in der Ecke des Wohnzimmers bereits einen langen Riss ausgemacht, aus dem ein Wasserfaden rann; der Anstrich daneben aufgedunsen, zerlaufen.
„Noch können wir von hier weg“, schrie ich dem Hausherren zu.
Er schüttelte den Kopf.
Im gleichen Augenblick gab die unterspülte Vordertür dem Drängen „Bebincas“ nach, riss aus den Angeln und segelte mit einem hohlen Knall gegen die Flurgarderobe, versuchte sich aufzubäumen, schlug zur anderen Seite aus, ein Vogel mit gebrochenem Flügel, ächzend. Die hereinfegenden Sturmstöße verschlugen uns den Atem.
„Raus mit der Tür“, keuchte ich; ein erneuter Orkanstoß, ein zweiter, die dritte Böe verflog. „Jetzt!“
Wir wuchteten das Holzstück schmal gekantet in den Garten. Vom Himmel die fliegende See.
„Und das Seil!“
„Am Baum. Unten.“
Morast, sprudelndes Wasser. Ich ließ mich auf die Knie nieder, tastete, sah nichts, spürte nur Wellen, die über die Füße rollten. Endlich ein Stamm. Neben der Hauswand. Ein Knoten über der Borke. Und das Ende des Hanfseils unter Steinen. Ich riss und zerrte; schmatzend gab das Geröll den Strick frei. Eine freie Schlaufe; ich zog den Arm hindurch, kroch auf das Licht der huschenden Taschenlampe im Haus zu. Ein Mann im erhellten Rechteck presste eine massive Latte gegen die Innenpfosten. Sie bebte, wand sich zwischen den Händen, wollte zurück, in den Flur, zur anderen Tür, der offenen am Ende des Gangs, in das schäumende Meer.
Ich schlang das Seilende um die Latte, hielt sie der stürzenden Luft entgegen, fest.
Hammerschläge. Kein Wort mehr. Die Latten passten, wurden quer an den Innenrahmen genagelt, am Seil, eine nach der anderen. Füllten die Öffnung.
Endlich: „Mehr geht nicht“, brüllte der Hausherr hinter dem Holz. „Jetzt noch die Außenpfosten.“
Als ich mich aufrichtete, fuhr ein Wirbel die Hauswand entlang, verbog den Rücken, schleuderte die Beine seitwärts. Schlamm. Ich hielt mich am Seil fest, das Knäuel entwirrte sich, schwang herum. Immer noch Sumpf im Gesicht, im Haar, in tiefen Schrammen der Arme. Atempause. Der Wind war abgetrieben, zur anderen Hausseite. Der Hanf immer noch in meinen Fäusten.
Ich riss mich zusammen, robbte mit allen Kräften, die mir „Bebinca“ zugestand, zur hinteren offenen Tür.
Mein Bekannter wartete bereits; weit aufgerissene Augen, als der Lichtstrahl mich streifte, zurück kehrte, innehielt.
„Hier, das Seil, halt' es, bind' es fest, irgendwo.“
Ich spürte, wie sich der Strick spannte, ruhiger wurde, vibrierte.
„Schlag' die Tür zu. Und Haken ins Holz. Schneller.“
Der Hausherr wütete gegen die Tür.
Ein letzter Blick.
„Los jetzt! Nach vorn.“
Banden uns Latten auf den Rücken, jeder acht, und lange Nägel, in groben Säckchen, und den Hammer zwischen Hemd und Hose. Hielten uns am Seil, Meter um Meter vorwärts gegen „Bebinca“, Wind- und Wassersträhnen.
Nagelten auch die Außenpfosten zusammen, vorn.
Kurz nach halb eins saßen wir im Geländewagen; ein geschlossenes Vehikel, das mein Gastgeber im Schutz einer Steinböschung am Roxas-Boulevard abgestellt hatte. Irgendwo neben uns zog das Taifun-Zentrum vorbei; der Wind drehte, fast um 90 Grad. Hielt keinen Augenblick im Wüten inne.
Wir fuhren. Erstarrter Boden unter den Reifen. Offensichtlich die Straße, randvoll, breiige Bäche. Ob uns tatsächlich der Roxas-Boulevard trug, konnte keiner mit Sicherheit sagen. Als der Belag unter dem Wagen in einer Kurve entschwand, gerieten die Profile in Schlamm und drehten durch, der Wagen stellte sich quer; einer der Reifen schurrte dabei über Kopfsteinpflaster – eine Auffahrt! Die Räder kletterten wieder, fanden auf die Straße zurück, die jetzt anzusteigen begann. Oder? Wasser schoss uns entgegen, überspülte den Radkasten, Wellen sandigen Regens hasteten durch die offenen Fenster. Das Gefährt schlingerte, wollte den unsichtbaren Abhang zum Meeresufer hinunter.
Im nächsten Augenblick fanden die Scheinwerfer im Nebel des Regens einen Halt; tote Öffnungen in einer verbeulten Karosserie; ein Bus, verlassen, versperrte Teile der Fahrbahn. Sturmattacken verfingen sich, stemmten das Blech, verließen es fauchend, das Skelett schlug um sich, als wüte der Atem des Lebens in ihm; im aufgerissenen Motorblock Reste eines Leitungsmastes und die Maske einer Ampelanlage. Als wir näher heranfuhren, bemerkten wir die verkohlten Sitze im Inneren des Busses; ausgebrannt. Das Bild erinnerte mich an eine Nacht im Hurrikan auf Jamaica, an den aufblitzenden Feuerschein der Kurzschlüsse über den Spitzen der elektrischen Leitungsmasten, an Funken sprühende Drähte einer Starkstromleitung, die sich über dem durchnässten Boden wie eine Schlange wand und vieles in Brand setzte, mit dem sie in Berührung kam; oder auch Menschen durch Stromschlag tötete.
Diesmal schienen alle Insassen rechtzeitig den Bus verlassen zu haben; vielleicht war zu einem späteren Zeitpunkt das Benzin in Brand geraten, als die sturmbewegten Metalle Funken schlugen.
Vorsichtig umfuhren wir das Wrack; an der Hauswand vor uns schaukelte im Rhythmus der Böen ein Straßenschild, Roxas-Boulevard. Jetzt konnten wir hoffen, an einer der nächsten Kreuzungen in das Stadtinnere vorzudringen. Bevor „Bebinca“ die Winde weiter verkehrte und der Orkan die See wieder ans Ufer trieb. Und auch das nahe gelegenen Stadtviertel überflutete.
Die meisten Straßen, die in den Boulevard einmündeten, glichen jetzt einem Flussdelta; einige Wasserarme hatten unterwegs Geröll aufgesammelt oder Pflastersteine ausgegraben und sie vor dem Roxas zu Barrikaden aufgetürmt. Tropfen zerstäubender Bäche sammelten Reste von Licht; ihre Kaskaden schimmerten grau im allgegenwärtigen Schwarz.
Ich versuchte mich zu orientieren; wie viele Kilometer hatten wir schon zurückgelegt? Schafften wir es mit dem Jeep bis zur Quirino Avenue, könnten wir der gefährlichen Küstenstraße entkommen.
Polternder, dann schurrender Lärm auf der Landseite – von einem der unsichtbaren Häuser am Boulevard schleuderte der Orkan gerade einen halbierten Dachstuhl auf die Fahrbahn; im letzten Moment riss mein Bekannter das Steuer herum, konnte den Wagen nicht mehr gegen den Sturm halten; es knirschte, wir fuhren auf den zwei Seitenrädern, kippten zurück, Federungen knackten, der Wasserstrom einer Seitenstraße brandete über die Fensteröffnungen, Wellen aus Schmutz- und Mörtelteilchen, bis zu den Knien; der Motor verstummte, das Gefährt rutschte von der zerbröselnden Straßenkante, der Böschung zum Meer entgegen, hilflos.
„Raus hier, zu mir herüber!“, schrie ich und zerrte meinen Bekannten über das Schalt- und Bremshebelwerk hinweg zur aufgesprungenen Wagentür; auf der anderen Seite stemmten sich Wasserkaskaden und Sturmböen gegen die Karosserie.
Als wir uns im Morast zum Boulevard hinauf arbeiteten, gab der Jeep ein dumpfes Stöhnen von sich, wirbelte mit dem Heck zur See und verschwand hinter der Regenwand.
„Er war ja auch schon alt“, bemerkte der Besitzer müde. „Und wohin gehen wir jetzt?“
In der Ferne, über dem verborgenen Häusermeer Manilas, war ein schwacher, eng begrenzter Feuerschein aufgestiegen; vielleicht ein Haus oder eine Hütte, deren Bewohner im Sturm die Kontrolle über eine brennende Kerze verloren hatten.
„Dorthin“, sagte ich und wies auf den Glutfleck. „Dort sind Menschen.“
Ein mühseliger Marsch; umgeworfene Zäune, Enden mit Stacheldraht, eingedrückte Hauswände, Schutthügel, Hände schräg vor dem gesenkten Kopf, Flugobjekte, Rahmen und Schindeln in der Luft, Ohren in alle Richtungen, Gesang der Bleche, trudelnd und flach schnellend mit jeder neuen Böe. Und endlich äußerlich unversehrte niedrige Häuser, leblos, von den Bewohnern verlassen. Wenig später eine Straße, massivere Gebäude, einige mehrstöckig; hinter den geschlossenen Fenstern vieler Wohnungen Glimmen von Petroleum-Leuchten, Ahnung von Licht; vereinzelt Notstromaggregate, üppige Helligkeit.
In den Zugängen der Häuser Gruppen von Flüchtlingen, Hausrat in verschnürten Stoffbahnen neben sich. Wer Glück hatte, hockte auf Treppenstufen, zuallererst Kinder. Die meisten Haustüren eingedrückt, auf dem Boden, vom Wasser überspült; andere noch in den Angeln, bei scharfen Windstößen um sich schlagend, Bugwellen schwappten ins Innere. Das Wasser stieg augenfällig, kroch in die Häuser, höher, eroberte Absätze.
Ob es weiter stadteinwärts ein Durchkommen gäbe, wollten wir wissen. Schulterzucken. Wenn das Wasser hier weiter stieg – möglich. Logik, ich grübelte.
Wir stapften auf gut Glück los; eine Querstraße, bogen ein, den Sturm jetzt im Rücken, Wasserspiele um die Waden. Schon. Auf einem Balkon dröhnte ein Generator, mindestens 100 Dezibel, Strähnen gelben Rauchs vor dem erleuchteten Fenster.
Die Strömung in der Straßenmitte nahm Tempo auf, ein leerer Kinderwagen, zerschlissen, schoss vorbei, blieb an einem Holzregal hängen, wirbelte einige Male um die eigene Achse, kam frei, überschlug sich und setzte die Reise ins Überall fort.
Wir drückten uns dicht an die Hauswände, eine neue Ecke; dahinter – in Wohnungen zehn, zwölf Meter über dem flutenden Wasser – ein Halbrund zitternder Lichter – ein Platz. Glas splitterte. Ein Sturmstoß fing sich im Kreis der Gebäudefronten, heftete meinen Begleiter an die Emaille eines Chicken-Lokals. Vergeblicher Versuch, loszukommen. Luftnot, Vakuum im Rachen.
„Fallen lassen!“
Zögernd entspannt er sich, sinkt zur Seite, Wellen über den Kopf. Ich helfe ihm auf.
Am Ende des Platzes reicht das Wasser bereits bis zum Nabel; Einwohner fliehen aus den unteren Stockwerken der Gebäude, wenige flüchten sich auf flache Dächer, binden sich an Entlüftungsrohre.
Ein älterer Mann schiebt sein Fahrrad, vielleicht seine Lebensgrundlage, durch die Strudel, unschlüssig, was er damit zurzeit anfangen, wo er es sicher vor Diebstahl unterbringen könnte.
„Hast du ein bestimmtes Ziel“, erkundigt sich mein Weggefährte, „oder legst du es darauf an, zu schwimmen?“
„Wenn nötig ...“, sage ich vage. „Aber ich erinnere mich, dass es irgendwo weiter vorn, ein, zwei Plätze weiter, einen Geländeanstieg gibt, mit einer massiv gebauten Schule. Oder war es eine Kirche? Dort könnten wir vielleicht die Flut aussitzen, vom Sturm etwas geschützt, möglicherweise sogar im Trockenen.“
„Mir ist kalt; sehr kalt.“
„Tritt das Wasser, wenn's der Untergrund erlaubt, schieb' dich nicht nur durch. Das hilft dem Kreislauf.“
Jeder Schritt eine Qual; der Widerstand des Wassers schien sich mit jedem Meter zu vervielfachen, Wellen wölben sich auf, die Brust fühlte sich wund an, die Muskeln verkrampften; Inseln aufgetürmten Mülls umrollten unsere Körper, hölzerne Nagelleisten verfingen sich in den Resten der Kleidung. Durch die Sohlen der Schuhe spürte ich das Glas zersprungener Flaschen, ein Geschiebe aus Metall, Pfählen, Töpfen, gallertartigen Paketen. Jetzt nur nicht straucheln, in ein Loch geraten.
Eine Treppe, deren oberste zwei Stufen noch nicht vom Wasser überspült wurden, versperrte den Weg. Sie mochte Teil einer Rampe gewesen sein, deren Trümmer bis in Kniehöhe ragten.
„Rauf hier, ein paar Minuten. Ausruhen.“
Mein Begleiter nickte dankbar.
„Aber gut festhalten“, fügte ich hinzu.
Wir kauerten uns auf die oberste Stufe.
„Meinst du nicht auch, dass der Orkan etwas nachgelassen hat?“
Er blickte mich hoffnungsvoll an.
Tatsächlich. Ich hatte es auf die geschütztere Lage hinter der Häuserzeile geschoben, doch der Sturm war eindeutig abgeflaut.
„Und? Ist der Taifun endlich abgezogen?“
Mein Bekannter war offensichtlich am Ende seiner Kräfte. Ohne Erholung, gestand ich mir ein, würde ich es auch nicht mehr all zu weit schaffen.
„Sicher“, sagte ich, um ihn zu beruhigen, „über Land schwächen sich diese Ungeheuer schnell ab.“ Das war die Wahrheit.
„Jetzt zieht „Bebinca“ ins Chinesische Meer.“
Das war auch nicht gelogen, verschwieg aber, dass wir die Atempause lediglich der Nähe des Zentrums unseres Taifuns zu verdanken hatten. Von einem sogenannten Auge des Wirbels, einem Gebiet mit Windstille und wolkenlosem Himmel, würden wir zwar nicht profitieren – das Zentrum rutschte wohl südlich an uns vorbei –, doch zu einer vorübergehenden Abschwächung des Unwetters reichte es allemal.
„Gleich lässt auch der Regen nach.“
Als hätten die Güsse nur auf ihr Stichwort gewartet, stellten sie plötzlich den Betrieb ein. Kaum noch ein Tropfen; am Himmel wurde es heller; mit etwas Fantasie konnte man sogar ein paar Sterne erahnen.
„Dann könnten wir doch gleich hier warten; bis die Überflutung zurückgeht.“
Ich schüttelte den Kopf.
„Das kann hier Tage dauern.“
Gelogen. Ohne neue Sturzbäche würde es höchstens zwei Stunden dauern, bis das Wasser abgelaufen wäre, fügte ich in Gedanken hinzu. Aber einem 'Zentrum' folgte ja notwendigerweise ein neuer Wolkenwall, ausgerüstet mit Sturm und Regenfällen. Das stand uns bevor, und es würde nicht lange auf sich warten lassen.
2
Am Horizont begann es zu wetterleuchten. Der Ringwall schien rascher heraufzuziehen, als ich angenommen hatte.
„Komm“, drängte ich, „je länger wir hier oben hocken, um so mehr kühlen wir aus.“
Widerwillig folgte er mir; vermutlich nagten Zweifel an ihm, ob ich ihm auch wirklich die Wahrheit gesagt hatte.
Verglichen mit der Kühle unseres luftigen Rastplatzes fühlte sich das Wasser fast warm an.
Wir verließen den Platz; aus der Innenstadt floss weiteres Wasser zu. Bald reichte der Pegel bis in Brustnähe. Neben uns hatten sich einige Familien und ihre Nachbarn in einer Reihe im Schlamm verankert und reichten über ihre Köpfe hinweg Babys und kleine Kinder weiter; drei hochgewachsene Männer trugen sie in ein mehrstöckiges Fabrikgebäude.
Nach einer Viertelstunde zeigte das Fehlen neuen Regens Wirkung – der Wasserstand sank langsam. Dafür lieferten die näher gerückten Blitze jetzt kräftigere Donnerschläge.
Zögernd, wie nebenbei, fielen erste große Tropfen. Ich zeigte nach vorn, ich hatte mich nicht geirrt:
„Dort, die Kirche!“
Am Ende der Straße, von grell-blauen Blitzen in Licht getaucht, ragte auf einer Anhöhe der Glockenturm einer Kirche in den Tropensturm.
Vielstimmiges Gemurmel empfing uns.
Auch wir kamen noch unter, auf dem Gestühl des Hauses, vollständig durchnässt, in einem trockenen Gotteshaus.
Als die schweren Böen der Rückseite „Bebincas“ aus den Wolken brachen, verankerte der Küster die schwere Kirchentür mit einer Eisenstange.
Mein Begleiter schlief bereits.
**
Manila, 3. November, 16 Uhr Ortszeit
Tagebuchnotizen
Der Sturm hat uns verlassen; jetzt erwärmt die schon tief stehende Sonne von einem klaren blauen Himmel die geschundene Stadt und ihre Menschen. Einzelne Stadtteile verfügen bereits wieder über Strom.
Im Internet berichtet „Manila Bulletin“, dass nach vorläufigen Schätzungen mindestens 43 Menschen durch die Fluten „Bebincas“ ertrunken sind.
Spricht man die Hauptstädter auf das erlittene Leid an, winken sie höflich lächelnd ab.
„Fliegen Sie nur zurück in ihr Land! Den Flughafen haben wir bald aufgeräumt.“
Juans Eigenheim hat erneut das Blechdach verloren. „Die neuzeitlichen Reifen taugen nichts mehr“, sagt er. Wir tranken gemeinsam einen Reisschnaps.
Auch mein Bekannter vom Meeresufer gehört weiterhin zu den Hausbesitzern. Er schwört jetzt auf vernagelte Türen. Das Dach muss er allerdings neu decken. Er sitzt inmitten der aufgequollenen Holzmöbel und wartet auf Frau und Kinder. „Vielleicht kommst du ja mal vorbei, wenn gerade kein Taifun in der Nähe ist“, meint er. Ein undankbarer Mensch.
Das Tagesgestirn versinkt jenseits der lädierten Manila-Bay hinter dem Horizont. Gold-gelbe Streifenmuster hoher Eiswolken leuchten auf, letzte Erinnerung an „Bebinca“.
Ich klappe meinen Angelhocker zusammen. 'Schneematsch', denke ich, 'ist wirklich harmlos. Und langweilig dazu.' -
* *
Haarsträubende Begebenheiten, Liebe, Macht und Intrigen das Leben einer baltischen Grafenfamilie
Ein Roman, oder doch nicht?
Ein Roman kann realistischer sein als ein Gespräch unter vier Augen Unfassbare Ereignisse führen durch den Zweiten Weltkrieg bis zum heutigen Tag, schildern in Life-Rückblenden Leben und Intrigen am Hofe Katharinas der Großen, veranschaulichen die wahnwitzige Va-terlandsliebe, Ehre und Treue eines Kavalleriegenerals des Zaren im ersten Weltkrieg, oder lassen die poetischen Amouren Goethes und Wielands mit der dichtenden Urahnin dieser Zeit wie in Gegenwart aufleben. Die durch das Geschehen führende Person erzählt von Annamaria, der im Kugelhagel zerfetzten Fluchtfreundin, von dem nach England entführten Bruder, von der Besatzungszeit und Kindheit nach dem Krieg, von Rock n' Roll und Rebellion der Halbstarken, von gesellschaftlichen und religiösen Gegensätzen in der Familie, vom Sohn, dem Tunichtgut, den eine Türkin zähmt und von einer fast überirdisch gelenkten Liebesgeschichte eine Handlung wie im Film, die auch die Zeit bis heute dokumentiert.
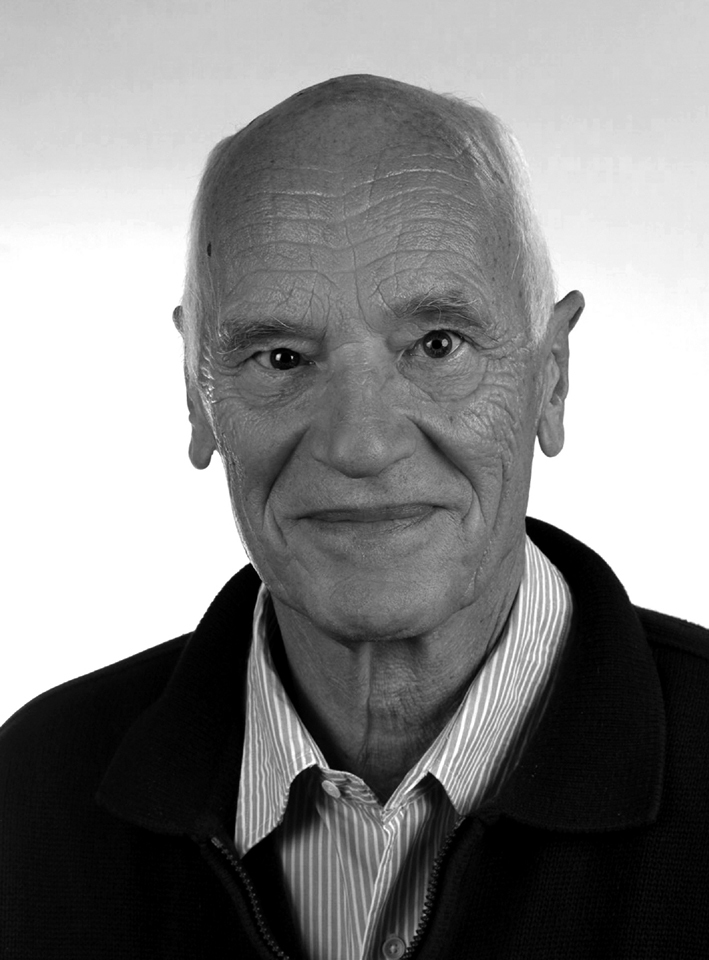
Peter Graf von Keller, geb. 1941 im heutigen Polen, durchlitt das Trauma der Flucht, durchlebte eine von Kinderarbeit geprägte Wanderung durch die Schulzeit, ging den bitteren Gang eines „Blaublütigen“ von der Lehre bis zum Dipl. Agraringenieur FH, genoss 14 Jahre Paris als Direktionsreferent einer international tätigen europäischen Vereinigung und „lebte“ schließlich den Job eines „PR-Mannes“ bis zur Rente. „Nicht Blut ist adlig, die Gesinnung ist es“, steht auf seinem Familienwappen.
Peter Graf von Keller: Wenn die Sterne Tango tanzen, 207 Seiten, Broschur, €13,98, ISBN: 978-3-86992-068-9
Titelbild zum Download (300 dpi)
©2011-2020

1. Das Gespräch
„Das Essen schmeckt wunderbar und der Rotwein passt ganz ausgezeichnet.“ Tara schenkte dem Ober ein gezwungenes Lächeln und senkte ihren Blick wieder in ihr Lammfilet in Balsamico-Rosmarin-Sauce. Eigentlich war es ihr verhasst, aufgesetzte, gut gelaunte und platte Sprüche über Esskultur von sich zu geben. Aber was konnte schließlich der arme Kellner dafür, dass sie sich heute Abend so richtig mies fühlte. „Was mache ich hier eigentlich?“, fuhr es Tara durch den Kopf. Sie war wütend, sie war verletzt und sie fühlte sich unendlich gedemütigt.
Wenn sie das täte, wonach ihr zumute war, würden die Lammfilets mit Schmackes an der Designerwand landen. Wütend würde sie zuschauen, wie diese dort kleben blieben und langsam unter den staunenden Blicken der Gäste und des Servicepersonals auf einer Soßenspur in die Tiefe rutschten. Und der Rotwein. Der würde sich über den hübschen Kopf ihres Tischnachbarn ergießen. Der Mann mit dem hübschen Kopf, der Taras Meinung nach die Dusche im teuren Rotwein mehr als verdient hatte, war ihr Freund und Lebensgefährte Alexander. Tara ließ trotz aller Wut den Wein in den Pokalen, und auch die Filets blieben artig auf ihrem Teller. Alexander hatte ihr schon mehrfach zu verstehen gegeben, dass er ihre Gefühlsausbrüche nicht schätzte. „Du bist in allem, was du tust, viel zu emotional“, war einer seiner Begleitsprüche. „Kunststück!“, dachte Tara dann, „wer keine Gefühle hat, kann sie auch nicht raus-lassen!“
Der Abend war nur die Spitze des Eisberges gewesen, die restlichen schmerzhaften Eisbergereignisse schwammen noch in den Tiefen ihrer Erinnerung herum. Tara wäre es am liebsten, wenn sie von dort aus direkt mit irgendeiner Meeresströmung in Richtung Nordpol verschwinden würden. Doch sie taten ihr nicht den Gefallen. Das Wochenende war derart desaströs verlaufen, Tara hatte ab sofort eine klare Vorstellung, was man unter „Life changing“, lebensverändernde Ereignisse, verstand. „Eines ist mal ganz sicher“, dachte sie, während sie lustlos und traurig auf ihrem Teller herum pickte, „so konnte und würde ihr Leben nicht weiter gehen.“ Nur in welche Richtung es gehen sollte, das wusste sie jetzt und in diesem Moment ganz und gar nicht.
Sie waren, wie so oft am Sonntagnachmittag, miteinander an der Elbe spazieren gegangen. Tara hatte Alexander gefragt, wie er es fände, wenn sie ein Kind bekämen und dann sie, Alexander und das Kind zusammen eine Familie wären. Mit dem, was dann kam, hatte Tara in ihren schlimmsten Albträumen nicht gerechnet. Alexanders bekam einen Wutausbruch, der einem Feuer speienden Drachen alle Ehre gemacht hätte. Er war richtig sauer geworden. Tara fragte sich, ob es wirklich ihr selbstbeherrschter Alexander war, der hier Gift und Galle spie. Alexander hatte ihr unverblümt mitgeteilt, dass er keine Kinder mit ihr haben wollte, dass er überhaupt nicht daran dachte, mit ihr eine Familie zu gründen. Tara konnte kaum glauben, was er da sagte, mit welcher Kälte und Wut er es sagte. Sie dachte, sie träumte seine Worte nur, träumte alles, was dermaßen schmerzhaft geschah. Ihre Kehle war augenblicklich bis oben zugeschnürt, und ihr Bauch fühlte sich an, als würden rote Lavaströme im Sog eines Mahlstromes rotieren. Ihre Augen brannten vor geweinten und ungeweinten Tränen und eine eisgraue Kälte kroch über ihr Rückgrat vom Steißbein bis nach oben zu den Schulterblättern.
Jetzt, wo sie erneut daran dachte, zitterten ihre Hände immer noch und ihre Gedanken fühlten sich so taub an, als hätten sie ihr Haltbarkeitsdatum weit überschritten.
Es war einfach nur ungerecht. Alles war ungerecht. Alles, einfach alles. Aber am ungerechtesten waren die Anschuldigungen, die Alexander gemacht hatte. Sie würde zu wenig Geld verdienen, hatte er ihr vorgeworfen. Er würde sich, sollten sie denn eine Familie haben, finanziell um alles kümmern müssen, während sie mit einem Halbtagsjob für ihr Vergnügen sorgte. Taras sogenannter Halbtagsjob war eine halbe Stelle als Sportlehrerin an einem Hamburger Gymnasium. Die Stelle war so, als halbe Stelle eben, ausgeschrieben gewesen, und Tara hatte sie angenommen. Da sie nicht von der Arbeit in der Schule allein leben konnte, verdiente sie ihr Geld zusätzlich als Übersetzerin für Französisch und Englisch. Dummerweise hatte sie ihren zweiten Job, den Dolmetscherjob in einer großen Hamburger Firma, verloren, wurde vor einem Monat vor die Tür gesetzt. „Betriebsbedingte Kündigung“ nannte es sich. Die Finanzkrise hatte zugeschlagen und bei ihr ganz persönlich an die Haustür geklopft. Aber sie brauchte das Geld und sie wollte die Arbeit, wollte das Gefühl, arbeiten zu können. Sie war über die Kündigung unendlich traurig.
Seit drei Jahren waren Tara und Alexander ein Paar. Trotzdem hatten sie all die Jahre über zwei getrennte Wohnungen behalten. Vor allem Alexander war es wichtig gewesen.
Natürlich lagen in Alexanders Wohnung ein paar persönliche Sachen von ihr. Zahnbürste, Schlafanzüge, Gesichtscremes, Unterhosen, Tampons, was man halt so braucht. Sie verbrachten vor allem die Wochenenden miteinander. Spielten Tennis, gingen laufen, ins Kino, auf Partys. Das klassische Programm für ein Paar ohne Kinder. Sie waren fast jeden Freitag und Samstag unterwegs. Aber zu einer gemeinsamen Wohnung war es irgendwie nie gekommen.
Alexander hatte das „Gehrock“ an diesem emotional verhagelten Sonntagabend vorgeschlagen, um Tara auf andere Gedanken zu bringen, um sie vielleicht sogar aufzuheitern. Tara wusste das und doch schien ihr die Geste zu durchsichtig, zu nichtssagend. So schnell konnte sie die Ereignisse des vergangenen Tages nicht vergessen. Ihr Blick war so trübe, als würden sie ihre Mahlzeit nicht im Sternerestaurant, sondern in einem dunklen Kohlenkeller zu sich nehmen.
Das „Gehrock“ war, sah man von diesem Abend mal ab, eines ihrer Lieblingsrestaurants im Hamburger Szeneviertel Eppendorf. Der Laden hatte sich durch eine herausragende Kritik in einer Gourmetzeitschrift zu einer festen Größe am Hamburger Restauranthimmel etabliert. Wenn man hier essen gehen wollte, so sollte man als Nicht-Eingeweihter einen langen Atem besitzen. Alexander war ein Eingeweihter. Er zählte zu den Günstlingen des Küchenchefs. Sternekoch und Besitzer Sven Gehrock und ihr „Liebster“ Alexander spielten gemeinsam in einer Tennismannschaft der Altersgruppe „Herren 30“. Alle acht Mitspieler standen mitten im Berufsleben. Also reichten ihre sportlichen Ambitionen nur für die Bezirksliga, aber auch da musste man einige Male den Ball übers Netz befördern, bis es hieß: Spiel, Satz und Sieg. Soviel gemeinsam durchlebter Schweiß und Leid auf und abseits des Spielfeldes verbindet, und Alexander hatte sich seinen Stammplatz im „Gehrock“ mit gutem Topspin und gefühlvollem Rückhandslice fest erspielt.
Tara zerfleischte sich seit dieser Kündigung schon genug. Sie fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut, hatte sich mit Schuldgefühlen verrückt gemacht. Obwohl das Wort „Finanzkrise“ in allen Medien immer und immer wieder thematisiert worden war, hatte sie es sich persönlich angekreidet, es als persönliches Versagen empfunden, als sie den Job verlor. Ihre Familie und ihre Freunde versuchten, sie davon zu überzeugen, dass sie alles richtig gemacht hatte, dass die Kündigung nichts mit ihr zu tun hatte, nicht von ihren Fähigkeiten oder Leistungen abhing. Inzwischen glaubte sie schon fast selbst daran: Sie hatte keine Schuld an der Kündigung. Es war einfach gottverdammtes Pech. Umso ungerechter war dieser Streit mit Alexander gewesen. Er riss ihr mühsam aufgebautes Gebäude von positiven Argumenten ein wie ein dünnes Spinnennetz.
„Du bist viel zu sprunghaft, nicht strukturiert genug für eine Familie. Du kannst ja nicht mal auf eigenen Beinen stehen und du würdest die Verantwortung für eine Familie voll und ganz auf mich abladen“, waren Alexanders Worte. „Und der Verlust an materieller Sicherheit, all die Einschränkungen“, so Alexander. „Das ist in keinem Fall meine Vorstellung von einem glücklichen Leben.“
Taras Tränen liefen unkontrolliert über beide Wangen, als sie schüchtern einwand: „Aber Kinder sind doch auch etwas sehr schönes. Willst du wirklich alt werden und als einzige Erinnerung auf deine Sammlung von Tennispokalen schauen?“
Taras Blick fiel auf die dunkelbraunen Sitzbänke, die aus glatt poliertem abgesteppten Leder waren und aussahen wie Chesterfield Clubsessel. Der Rest des modernen großen Raumes wirkte nicht annähernd so gemütlich wie die Lederbänke. Gebürsteter grauer Stahl und grün gefärbte Milchglasscheiben erinnerten eher an die Räume einer Werbeagentur, als an ein Gourmetrestaurant. „Aber vielleicht ist das ja der Trick“, dachte Tara mit Galgenhumor. „Es sieht genauso aus wie das Büro, in dem man den ganzen Tag hinter dem Rechner hockt. Niemand spürt den Übergang.“ Statt der Tastatur lag ein Teller samt Besteck auf dem Tisch und man musste nur aufpassen, dass man statt mit den Fingern mit Messer und Gabel in das Geschehen eingriff. Tara wusste, dass sie heute und mit dieser finsteren Laune kein gutes Haar an ihrer Umgebung lassen würde.
Eigentlich wusste Tara gar nicht, warum sie Alexanders Einladung überhaupt angenommen hatte. Sie fühlte sich unendlich verletzt und war Alexanders betont gute Laune einfach nur leid. Und diese sinnentleerten und durchgeplanten Wochenendrituale, die organisiert waren, als wären sie von einer Lifestylezeitschrift zusammengestellt, gleich oben drauf! Aber das Schlimmste war Alexanders Zurückweisung gewesen. Sie hatte sich ihm geöffnet, ihm ihre Liebe für die Ewigkeit, ihre Bereitschaft für eine gemeinsame Familie angeboten. Und er? Er hatte sie und ihre Wünsche zurückgewiesen, als hätte sie ihm statt einer Familie ein Stück gammeliges Fleisch angeboten. Aber das Beste an der ganzen Geschichte war: Alexander gab ihr die Schuld daran, dass er keine Familie wollte.
Tara schob die Ärmel ihres französischen Armeeparkas, dem eine findige Designerin ein großes, rotbuntes Kreuz in bestem Katholenkitsch auf den Rücken gestickt hatte, über die Ellbogen und zog sich eine Haarkralle aus der Parkatasche. Mit einer entschlossenen Geste packte sie ihr wuscheliges dunkles Haar, drehte es im Nacken zu einer Rolle zusammen und steckte es hoch. Alexander betrachtete die ihm vertrauten Gesten mit zusammengekniffenen Brauen. Auch ihm stand das vergangene Wochenende noch vor seinem inneren Auge und auch ihm war klar, es gab wenig Anlass für ein heiteres, leichtes Abendessen. Und zu einer angeregten Plauderei über Filme, Bücher, Politik und Philosophie würde Tara sich heute auch nicht eignen. Er wusste, was er Tara vor ein paar Stunden gesagt hatte, würde er nicht mehr zurücknehmen können. Und genau genommen meinte er es genau so, wie er es gesagt hatte. Er wollte es nicht zurücknehmen. Er würde die nächsten Wochen versuchen, den Ball flach zu halten, und er würde das Entschuldigungsprogramm fahren. Blumen, tiefe Blicke, kleine Geschenke. Er liebte Tara. Irgendwie und auf seine Weise. Und was die komische Idee mit der Familie betraf. Alexander war sich sicher, wenn er die nächsten Wochen ein bisschen nett und aufmerksam blieb, würde Tara das unsägliche Gespräch irgendwann vergessen.
2. Taras Geschichte
Tara und Alexander hatten sich in ihrem Tennisverein kennengelernt. Tara war, als sie die Arbeit an dem Gymnasium begann, aus dem Süden Hamburgs fort und näher ins Zentrum gezogen. Ihr alter Club lag jenseits der Elbe, und sie musste sich jedes Mal durch den verstopften Elbtunnel quälen, um auf die andere Seite zum Training oder zu Spielen zu fahren. Irgendwann hatte es ihr gereicht. Mit einer Party verabschiedete sie sich von ihrer Mannschaft und wechselte in einen kleinen Verein in der Nähe ihrer neuen Wohnung. Sie spielte im Jahrgang „Damen 30“. Älter als dreißig, sogar viel älter, durfte man sein. Jünger nicht. Ihre neue Mannschaft machte ihr den Wechsel leicht. Es gab nicht so viele Spielerinnen, die auch bereit waren, aktiv an den Medenspielen, den Turnieren zwischen den Tennismannschaften der Vereine, teilzunehmen.
Tara hatte Alexander eines Tages Tennis spielen sehen und sich sofort in seine „Vorhand Longline“ verliebt. „Die ist ja scharf wie eine Waffe“, zischte sie ihrer Mannschaftskollegin zu und blieb am Platz stehen, um weiter zu zusehen. Alexander sah sie aus den Augenwinkeln am Rand stehen, verschlug einen Ball und brauchte einige Schläge, um sich wieder auf das Spiel konzentrieren zu können. Er gewann dennoch.
„Du bringst mir Glück“, hatte er damals gesagt und sie zu einem Bier im Vereinslokal eingeladen. Von dem Tag an waren sie ein Paar. Für Tara war es nahezu unmöglich, gegen Alexander zu gewinnen, aber er war ein exzellenter Trainingspartner für sie.
Sie spielten, wenn sie nicht irgendwohin wegfuhren, jeden Samstag gegeneinander, tranken hinterher eine Apfelschorle oder ein Bier und quatschten eine Weile mit anderen Clubmitgliedern, bevor sie sich wieder auf den Weg machten.
So gingen die Jahre dahin und jeder im Tennisverein, in ihrem Freundeskreis und alle Verwandten waren der Meinung, Tara und Alexander wären so was wie „Mann und Frau“. Auch Tara hatte das bis gestern geglaubt.
„Vor ein paar Tagen hat er mir noch erklärt, dass er meine Verrücktheiten, meine ‚Eulenspiegelnatur’, wie er es nennt, über alles schätzt!“ Tara suchte Trost im Gespräch mit ihrer Freundin und Mitbewohnerin Maxi. Sie musste mit jemandem über die vergangenen Ereignisse sprechen, sonst, so hatte sie das Gefühl, würde sie platzen.
„Aber er versteht das irgendwie anders als ich. Er hält mich für einen lebensuntüchtigen Kasper!“
Maxi musste lachen. „Und du dachtest die ganze Zeit, du wärst die liebe Gretel.“
„Wofür braucht man Feinde, wenn man Freunde hat, wie dich“, heulte Tara und Maxi nahm sie tröstend in den Arm.
Tara und Maxi waren nicht nur Freundinnen, sie arbeiteten auch zusammen. In Altona teilten sich eine vier Zimmer Wohnung. Maxi gab den Kunstunterricht an ihrer Schule und verliebte sich überwiegend in Frauen. Als zweites Alleinstellungsmerkmal neben ihrer Bisexualität hatte sie einen untrüglichen Sinn für coole Wohnungs-einrichtungen. Was immer Maxi in ihren geschickten Fingern herumdrehte, hinterher sah es aus, als wäre es eine Installation, und ihre Wohnung glich einer Galerie. Maxi und Tara ergänzten sich großartig. Tara schätzte an Maxi, dass sie so anders war als viele andere Frauen aus ihrem Bekanntenkreis. Sie war weder zickig, noch spielte sie sich prinzessinnenmäßig in den Mittelpunkt. Stutenbissigkeit gab es nicht in ihrem Vokabular. In Maxi vereinte sich die Sensibilität einer Frau mit der Sachbezogenheit und Direkt-heit ihrer männlicheren Seite aufs Eleganteste. Tara hatte Homophobie noch nie verstanden, sie nahm grundsätzlich jeden Menschen so, wie er vor ihr stand. Wer war sie denn, anderer Leute Leben und Vorlieben zu beurteilen? Sollte doch jeder so glücklich werden, wie er oder sie es für richtig hielten! Solange jeder der Beteiligten damit glück-lich war.
Auch in ihrer Arbeit in der Schule ging es darum, ein Kind nicht irgendwelchen Vorstellungen zu unterwerfen. Vorurteilsfreiheit und Liebe zu den Kindern gehörten einfach dazu. Lehrer, die Lieblinge hatten, oder Schüler, aus was für Gründen auch immer, ablehnten, hatten ihrer Meinung nach schlichtweg ihren Beruf verfehlt. Und Maxi erschien ihr gerade, weil sie anders war, ein so wunderbarer und spezieller Mensch zu sein, dass sie es sich überhaupt nicht erklären konnte, was engstirnige Menschen daran zu kritisieren hatten. Maxi war für Tara die ideale Freundin. Nicht mehr und nicht weniger. Anfangs hatten einige Kollegen aus der Schule ihre Witzchen über das sportliche „Paar“ gemacht, aber Tara und Maxi gingen mit ihrer Freundschaft und unterschiedlichen sexuellen Orientierung so offen um, dass sich schließlich das ganze Kollegium gerne bei Partys um ihren Küchentisch versammelte.
Sport und ihre Arbeit als Sportlehrerin war für Tara ein Teil ihrer Lebensphilosophie.
Tara glaubte fest daran, dass Sport ein Allheilmittel für das Leben an sich sei und deshalb in keinem guten Haushalt fehlen durfte. Ohne Sport wurde man träge, fett und antriebsarm. Sie wusste instinktiv, dass es für jeden Menschen die passende Sportart gab. Man musste nur lange genug suchen, und jeder fand seinen sportlichen Deckel. So war ihr Sportunterricht von Anfang an kein Abhaken von Übungen gewesen. Sie reagierte darauf, was die Kinder brauchten, und es war ihr wichtig, sie für Bewegung zu begeistern. Wenn einer ihrer Schüler ihr stolz erzählte, dass er am Sonntag mit seinen Eltern im Park drei Kilometer gejoggt sei, konnte sie sich darüber freuen wie ein Kind am Geburtstagsmorgen.
Wie alle Lehrer wusste auch Tara, dass regelmäßige Bewegung heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr war. Die Kids verbrachten immer regelmäßiger viel zu viel Zeit vor Rechnern, Spielkonsolen und Nintendos. Sie wollte sich gar nicht ausmalen, wo diese Entwicklung hinführen würde! Ein erhöhter Zulauf bei Orthopäden, Ärzten und Psychotherapeuten war nur eine Seite der Medaille. Dass Sport auch dazu beitrug, Qualitäten wie Ausdauer, Mut und Spaß zu fördern, stand auf der anderen Seite. Tara wollte ihren Kindern all dies zumindest in kleinen Dosen mit auf den Weg geben.
Tara selbst hatte eine Vorliebe für alles, was mit Bewegung zu tun hatte. Vielleicht nicht gerade für Turm-springen oder Bungee-Jumping. Sie spielte aktiv Tennis, fuhr im Winter Ski, ging hin und wieder reiten, lief ganz gerne und hatte schon so ziemlich alle Gymnastikformen ausprobiert, die der Markt so in die Studios spülte. Vor ein paar Jahren war sie bei Yoga hängen geblieben. Irgendwie spürte sie schon nach der ersten Stunde, dass die Übungen des Yoga nicht nur rein zweckmäßige Körperformbewe-gungen waren. Die Weisheit vergangener Epochen turnte mit, und sie fühlte sich hinterher viel ausgeglichener als nach einer Stunde Stepp Aerobic. Neben der Arbeit hatte sie eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Und sie gab ein paar Stunden in einem Hamburger Studio.
Aber heute half ihr auch das geliebte Yoga nur bedingt aus dem Gefühlstief hinaus. Auch eine Stunde Tennis brachte nicht den gewünschten Erfolg. Ihre Mitspielerin beschwerte sich nur, dass ihr die Bälle so hammerhart um die Ohren flogen, dass es irgendwie auffällig war. „Ärger mit Alexander“, murmelte Tara entschuldigend, und ihre Mitspielerin nickte verständnisvoll.
Sie hatte sich gestern Abend nach dem Essen im „Gehrock“ von Alexander nach Hause bringen lassen und bat ihn, nicht mit reinzukommen. „Wir würden uns doch nur streiten.“ Alexander, der Taras Gefühlsausbrüche kannte, verstand auf der Stelle und fuhr davon.
Tara überlegte, wie sie die nächsten Wochen überstehen sollte. Sie klappte ihren Laptop auf und überlegte. „Es ist Ende Juni. Das Schuljahr ist gelaufen, die Zeugnisse geschrieben. Alle Tennisspiele in dieser Saison haben wir hinter uns.“
Eigentlich hatten Alexander und sie vor, die ersten zwei Wochen der Sommerferien gemeinsam zu verreisen. Sie wollten mit Alexanders BMW und zwei Mountainbikes runter an den Gardasee.
„Unmöglich“, murmelte Tara. „Ich kann jetzt ganz bestimmt nicht mit ihm in den Urlaub fahren. Ich muss weg. Irgendwohin, wo mich niemand kennt, wo ich nachdenken kann, und wo mich nichts ablenkt.“
„Lassen wir den Zufall entscheiden!“ Tara öffnete Google Earth, gab der Erdkugel vor ihr auf dem Bildschirm einen Schwung und zoomte mit geschlossenen Augen das Bild heran. Eine kleine Insel, die oberhalb einer Inselkette vor der afrikanischen Küste lag, erschien, während sich ihr Bild langsam schärfte, auf ihrem Display. „Fuerteventura“, murmelte sie. „Eine der Kanareninseln und mir vollkom-men unbekannt!“
Sie würde nichts googeln über Fuerteventura, sich nicht schlaumachen, nicht informieren. „Die Insel gehört zu Spanien, das heißt, man spricht mit 99-prozentiger Sicher-heit spanisch. Und Touristen gibt es auch, also wird man sich seine Lebensmittel anders besorgen können als mit Pfeil und Bogen. Das sollten genug Informationen sein!“
Tara öffnete ihr Mailprogramm und schrieb:
Lieber Alexander!
Es ist nicht sehr mutig, Dir meinen Entschluss in einer Mail mitzuteilen, aber wie du ja selbst immer sagst, bin ich sehr emotional. Das heißt, wenn wir uns gegenüberstünden, würde ich entweder anfangen zu heulen oder zu streiten. Beides magst du nicht, also bleibt es bei dieser Mail.
Unser Gespräch über Familie und Kinder hat mich verwirbelt wie ein Zyklon. Ich bin aus allem rausgerissen worden und ich kann nicht zurück.
Keine Angst, es gibt jetzt keine Kommentare, keine Urteile. Nur soviel: Mein Vertrauen in unsere Zukunft ist dahin. Wir denken und fühlen zu unterschiedlich. An diesem Punkt unseres Lebens tut sich da ein Graben auf. Entweder einer von uns springt, oder der Graben bleibt.
Ich werde wegfahren und sage dir nicht wohin. Aber du sollst wissen, dass ich alleine reise und über die Zukunft nachdenken will. Was aus uns wird? Ich weiß es jetzt in diesem Moment überhaupt nicht. Vielleicht finde ich die Antwort auf meiner Reise. Du sollst wissen: Ich habe dich geliebt, aber jetzt heißt es für mich auf jeden Fall: „Abschied nehmen“. Bitte versuch nicht, mich anzurufen. Gib uns beiden diese Pause.
Tara.
Nachdem Tara die Mail an Alexander abgeschickt hatte, wanderte sie in die Küche, um sich einen Tee zu kochen. Sie fühlte sich unendlich traurig und auch jetzt schon ein bisschen einsam, schließlich waren Alexander und sie drei Jahre lang zusammen gewesen. Während der Wasserkocher vor sich hinrauschte, holte sie die Kanne, den Tee und ihren Lieblingsbecher mit den Rosen aus dem offenen Regal.
Maxi und sie hatten die Küche, nachdem sie eingezogen waren, umgebaut. Alles, was vorher hier gestanden hatte, war auf den Sperrmüll gewandert. In der Mitte des nahezu quadratischen Raums stand ein runder Holztisch auf einem dicken, säulenartigen Fuß, der unten in vier Tigerkrallen mündete. Drum herum gruppierten sich Stühle, ein Sammelsurium aus verschiedenen Epochen und Stilen. Die Wände waren in einem dunklen Rot gestrichen, die Fensterbänke und der Rahmen dazu in Dunkelgrau. Tara hatte bei einem Tischler unten im Viertel eine riesige alte Buchenholzplatte stehen sehen. Der Tischler hatte sie ihnen so zugesägt, dass sie daraus Regale und eine unsymmetrische Arbeitsplatte bauen konnten. Rund um die Spüle, den Herd und den Kühlschrank wurden die Arbeitsplatten so installiert, dass sie ein Regalsystem bildeten. Oben schloss eine durchgehende Arbeitsplatte ab, und an den Seiten konnten sie in die entstandenen Nischen Töpfe und andere Sachen stellen. Es war ihr gemeinsamer Entwurf gewesen und alle, die in die Küche kamen, lobten begeistert.
An den Wänden hingen gerahmte Werke von Maxi. Abstrakte Gemälde. Grobe Pinselstriche auf durchgearbeitetem Hintergrund. Die Bilder sahen dekorativ und dynamisch aus. Tara fand sie großartig und ermutigte Maxi oft, sich einen Galeristen zu suchen. Maxi nickte dann großmütig. Das hieß soviel wie: Sie hatte wenig Lust, sich auf dem Kunststrich zu prostituieren, aber wenn es sich ergeben sollte, würde sie ihre Werke schon mal ausstellen.
Zischend goss Tara das heiße Wasser in die Teekanne und stellte den Wecker am Herd auf drei Minuten. Während sie auf den Tee wartete, holte sie ihren Koffer aus der Abstellkammer und begann zu packen. Der Wecker klingelte und sie brachte ihren Becher mit Tee und der Milch in ihr Zimmer. „Sommersachen brauche ich, soviel ist klar.“ Ein Badeanzug, Sandalen und ihre Kulturtasche flogen obendrauf. Sie hatte zwar noch keinen Flug, aber der Koffer sollte „Abmarschbereitschaft“ signalisieren. Sie wollte keinen Tag länger in Hamburg bleiben.
Im Flur hörte sie Maxi mit dem Schlüssel hantieren. Die Tür fiel ins Schloss, und ihre Freundin schnaufte vernehmlich, bevor sie ihre Taschen fallen ließ. „Hey, Sweety! Was treibst du so?“
„Ich hab gepackt und weißt Du, wohin ich jetzt reisen werde?“
„Nach Castrop-Rauxel?“
„Was soll ich denn da?“
„Ein Gleichgewicht herstellen zwischen innerer und äußerer Tristesse?“
„Wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich hab was ähnlich Schräges gefunden. Ich hau ab nach Fuerteventura.“
„Fuerteventura!“ Maxi überlegte. „Kanareninsel, gehört zu Spanien, Äquatorialnähe, Tourismus und viele Steine“, spulte sie aus dem Gedächtnis ab.
„Hört sich toll an, genau das Richtige für meine wunde Seele. Und wenn mein Gemüt sich gar nicht erholt, kommst du schnell angeflogen.“
„Um dich zu retten?“
„Wir könnten ein Vermögen damit machen, indem du am Strand Touristen porträtierst.“
„Oh ja, diese Art von Künstler wollte ich immer schon mal sein!“
Tara blinzelte mit den Augen und verschwand wieder in ihrem Zimmer. Auf ihrem Laptop gab sie „Flieg-in-den-Urlaub.de“ ein und suchte Flüge nach Fuerteventura.
Sie buchte den frühesten Hinflug mit verschiebbarem Rückflug für den nächsten Tag. „Wenn schon, denn schon“, murmelte sie und gab die Nummer ihrer Kreditkarte ein.
Am nächsten Morgen brachte Maxi sie mit ihrem Peugeot 307 zum Flughafen. Nachdem Tara sich eingecheckt hatte und ihren Koffer losgeworden war, umarmten sich die beiden Freundinnen zum Abschied.
„Ich wünsche dir, dass du dort all das findest, was du suchst und was du brauchst. Und denk dran: Alles wird gut! Manchmal tut einem das Schicksal erst mal weh, um dann Platz für etwas viel Schöneres und Größeres zu schaffen!“
Tara weinte ein paar Tränen, rieb sich die Hand über die Augen und drückte Maxi ganz fest.
„Falls ich mich nicht sofort melde, mach dir keinen Kopf. Ich will versuchen, nach vorne zu schauen, und na, du weißt schon!“
Maxi nickte verständnisvoll und winkte hinter ihr her, als Tara in der Sicherheitsschleuse verschwand.
3. Last-Minute Fuerteventura
Im Flugzeug nach Fuerteventura versuchte Tara, ein bisschen zu schlafen. Der Flug dauerte fast fünf Stunden, und die sollten erst mal gefüllt werden, während sie auf engstem Raum und mit angeklappten Ellenbogen vor sich hin schmorte. Sie erwachte davon, dass die Flugbegleiterin ihr das obligatorische Essenstablett auf das ausgeklappte Tischchen stellte.
Neben ihr saß ein sportlich wirkender Mann Mitte fünfzig in Jeans und Jeanshemd.
„Guten Appetit“, meinte er und begann, seine Pakete aufzureißen. Tara blinzelte mit den Augen und brauchte ein paar Minuten, um wach zu werden. „Waren Sie schon mal auf Fuerteventura“, fragte sie, denn sie hatte das Gefühl, ihr Nachbar wollte ein Gespräch eröffnen.
„Ja, ich bin dort sozusagen Stammgast. Ich hab Freunde dort. Freunde von früher. Ich bin früher leidenschaftlicher Windsurfer gewesen und hab mich in der entsprechenden Szene getummelt.“
„Und? Was machen sie heute?“
„Mein Mountainbike steht unten im Flugzeugbauch. Fuerte ist großartig, um Rad zu fahren. Was haben sie denn vor?“
Tara überlegte. „Gute Frage! Ich war noch nie auf Fuerte und hab keine Ahnung was, mich dort erwartet. Genauso genommen bin ich nach einem Streit mit meinem Freund geflüchtet. Ich hab das erste Ziel gewählt, das sich ergab.“
„Gute Wahl“, meinte ihr Nachbar. „Fuerte ist genau der Platz, um sich auszuruhen.“
„Und warum ist das so?“
„Ich weiß es nicht. Weil man nicht abgelenkt wird von seinen Gedanken? Man kann sie sozusagen zu Ende denken. Die Insel ist anders als die anderen Kanaren. Nicht so ‚dekorativ’, um nicht zu sagen nicht so pittoresk. Sie ist steinig und karg und hat die schönsten Strände der Welt. Natürlich haben Immobilienhaie versucht, die Insel stückweise zu verkaufen. Hat aber nicht funktioniert. Es gibt einige leer stehende Geisterstädte. Wenn es nach mir ginge, würden die nicht nur leer bleiben, sondern auch bald verrotten.“
Tara warf einen Seitenblick auf ihren Nachbarn. Seine Ansichten gefielen ihr. Es gab wenige Menschen, die so dachten.
„Und was macht man sonst so auf Fuerte, außer Rad fahren?“
„Surfen, Kiten, Windsurfen. Alles, was man mit Wind und Wellen machen kann.“
„Und wo macht man das?“
„Oben im Norden sind die Surf- und Windsurfspots. Die Wellen und der Wind sollen dort am Besten sein. Es gibt auch haufenweise Surf-, Kite- und Windsurfschulen und auf Fuerte wohnen sogar einige ehemalige Spitzensportler. Einer von ihnen besitzt dort auch eine Fabrik, wo Bretter, Segel und Lenkdrachen konstruiert werden.“
„Wie komme ich denn in den Norden?“
„Die meisten mieten sich ein Auto. Wer sich auskennt, mietet es schon vor der Abreise. Aber es gibt auch Taxen und Busse, wie überall.“
Tara bedankte sich für die Informationen in Kurzfassung und widmete sich ebenfalls ihrem Plastikessen.
Nach der Landung, während sie auf ihren Koffer wartete, kam ihr Sitznachbar vom Sperrgepäckschalter auf sie zu. Rechts von ihm schob er sein Mountainbike. Sie verabschiedeten sich herzlich und ihr Nachbar drückte ihr seine Karte in die Hand. „Thomas Wagner, Werbefilmproduktionen“ las sie und darunter stand eine Adresse in der Hafencity. „Falls du mal Gesellschaft brauchst, ruf meine Handynummer an. Wir könnten essen gehen.“
Tara fand, es klang ehrlich und ohne jeden Hintergedanken, also willigte sie gerne ein.
Die Ferienzeit in Deutschland hatte gerade begonnen, das Flugzeug war bis auf den letzten Platz besetzt. Auf dem kleinen Flughafen in Puerto Rosario wimmelte es wie in einem Bienenstock.
Tara erkundigte sich an den verschiedenen Schaltern auf Englisch nach Mietwagen, hatte aber kein Glück. „Die sind alle unterwegs!“, sagte man ihr. „Sie hätten vorbestellen sollen.“
„Hinterher ist man immer schlauer“, meinte Tara und seufzte.
„Am Wochenende sieht es besser aus. Versuchen sie es dann noch mal!“
Tara nickte und schob ihren Koffer vor das Gebäude. Taxen gab es scheinbar auch zu wenige, die meisten Touristen verschwanden in großen Bussen, die sie dann zu ihren Animationstempeln bringen würden. Das war also auch keine Option, um von hier weg zu kommen. „Vielleicht hätte ich doch nicht ganz so spontan abreisen sollen“, dachte Tara und bereute es jetzt ein wenig, dass sie sich nicht besser über die Insel informiert hatte.
Ein kleiner dicker Mann fiel ihr auf. Er war damit beschäftigt, einen Stapel mit Pappkartons auf einen riesigen Pick-up zu laden. Tara schlenderte zu ihm hinüber und fragte: „Señor! Tu Taxi para mi in Norte? Para?“ Sie hielt ihm einen Fünfzigeuroschein unter die Nase.
Der dicke Mann schüttelte mit dem Kopf. „Por favor!“, bat Tara. „No Taxis, no Bus!“
„Okay! El Norte! Y 50 Euros“, murmelte er und schmiss Taras Koffer neben die Kartons auf die Ladefläche des Pick-up. Tara kletterte in die Kanzel und versuchte, es sich in dem Wust aus Flaschen, Zeitungen, Essensresten, Bierdosen, Zigarettenkippen und leeren Kaffeebechern einigermaßen bequem zu machen.
Sie verließen das Flughafen Gelände, tangierten die Ausläufer der Hauptstadt und fuhren durch eine wüstenartige Landschaft in Richtung Norden. Tara blickte interessiert nach rechts aus dem Beifahrerfenster. Da sie nur wenig Spanisch konnte, schwieg sie. Allerdings konnte es ihr nicht entgehen, dass der kleine dicke Mann sie hin und wieder etwas gierig von der Seite anstarrte. „Vielleicht legt sich das, wenn ich mich vorstelle“, dachte sie, hielt ihm die Hand hin und sagte: „Tara, mi nombre es Tara!“ Der kleine Mann nickte, aber sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht in Richtung freundlichen Verständnisses. „Pablo.“ Er hielt ihr eine verschwitzte Pranke hin, und Tara schüttelte sie entschlossen.
Tara seufzte und beschloss, Pablos Merkwürdigkeiten keine weitere Beachtung zu schenken. Man sollte immer an das Gute im Menschen glauben, nahm sie sich vor und begann, sich aus ihrem grünen Parka und ihrer Kapuzenjacke zu schälen.
Pablo blickte auf seine Armaturen und wendete sich an Tara: „Du mir geben 50 Euro. No Gasolina. Müssen tanken!“ Tara fand es ein bisschen merkwürdig, dass Pablo ihr Geld jetzt schon haben wollte. Aber schließlich war es ihr Vorschlag gewesen, ihm 50 Euro für die Fahrt zu zahlen. Sie fischte einen Schein aus ihrem Portemonnaie und hielt ihn Pablo hin. Der schnappte mit seinen kleinen, dicken Fingern danach, als würde sie einem Hund einen Knochen hinhalten.
4. Luke
Pablo bremste und lenkte den Pick-up auf eine einsam gelegene Tankstelle, die an der Straße in Richtung Norden lag. „In the middle of nowhere“, staunte Tara. Kein Haus, kein Baum, nicht mal ein Kaktus durchtrennte die Sicht auf den Horizont. Rötlicher Sand und bunt schillernde Steine bedeckten den Boden, der in der Endlosigkeit vor Hitze flimmerte. Am westlichen Horizont lag eine Bergkette, die sich bräunlich und in Dunst gehüllt von der roten Erde abhob.
Das flache Tankstellengebäude, erbaut im Stil der spanischen Pueblos, wirkte auf Tara wie ein riesiges, von Aliens gelegtes Ei, das mitten in dieser unwirtlichen Wüstenlandschaft vergessen worden war. Eine etwas kleinere Mauer, die einen Anbau verbarg, grenzte an das Hauptgebäude. Windschiefe Türen und eine dunkle, schmutzige Glasscheibe wiesen in das Innere des Kassenhäuschens. Unter dem Fenster stapelten sich ein paar rote Getränkekisten. Tara sah zwei Zapfsäulen, die auf einem kleinen Podest in etwa fünf Metern Entfernung zu der weiß getünchten Baracke standen. Am Rande der weißen Mauer entdeckte sie einen auf die weiße Wand aufgemalten Pfeil mit zwei Nullen. Der Pfeil zeigte um die Ecke des Anbaus herum.
„Fehlt nur noch, dass irgendjemand das Thema von ‚Spiel mir das Lied vom Tod’ pfeift“, dachte sie und schwang sich vom Beifahrersitz. Etwas angeschlagen von der Hitze schleppte sie sich durch die flirrende Sonne auf das kleine, eingeschossige Gebäude zu. Tara trug noch ihre Jeans, die sie sich morgens wegen des klassischen Hamburger Schietwetters angezogen hatte. Die Jeans war ihr eigentlich zu warm, aber sie hatte nach dem langen Flug bisher nicht die Zeit gehabt, sich umzuziehen. Den Kapuzenpullover und ihren Parka trug sie mit den Ärmeln um ihre Taille gewickelt.
„Hamburg“, dachte sie beim Aussteigen, „ist weit weg. Tausende von Meilen weit weg!“
Sie wollte Alexanders Worte und seine Meinung über ihre angeblich unprofessionelle Lebensführung so schnell wie möglich vergessen. Sie war weder unprofessionell noch chaotisch, auch das würde sie und der Welt sich beweisen. Gewiss, sie war spontan und sie war sprunghaft, eben impulsiv. Aber was Alexander als unprofessionell verdammte, stellte sich nach ihrer Deutung anders da. Sie fand sich eher „intuitiv“. „Und immerhin bin ich damit schon 35 Jahre alt geworden“, murmelte sie trotzig in sich hinein.
„Ich werde“, so entschied sie theatralisch, „ab sofort dem Zufall in meinem Leben eine Chance geben.“
Tara lehnte sich an die weiße Wand des Anbaus und ließ ihren Blick über die Landschaft schweifen. Der Mann aus dem Flugzeug hatte recht: Nichts aber auch gar nichts lenkte ihre Gedanken ab.
Loslassen konnte sie die Ereignisse der vergangenen Tage noch nicht, zu frisch war das Chaos, das Alexanders Worte in ihr angerichtet hatte. Tara überlegte einen Moment, wer aus ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis eigentlich eine Familie oder zumindest Kinder hatte. Viele waren es nicht. Die meisten der Frauen, die sie kannte, hatten sich für die Karriere entschieden, hatten studiert und einen festen Job angenommen. Tara erinnerte sich an ein Klassentreffen, auf dem sie vor zwei Jahren in der Hamburger Kunsthalle gewesen war. Ein ehemaliger Mitschüler aus ihrem Englisch-Leistungskurs arbeitete dort als Kunsthistoriker, so konnten sie das Café kostenlos für das Klassentreffen mit ihrem Abiturjahrgang nutzen. Es war, gegen alle Erwartungen, ein lustiger Abend geworden. Sie hatte ursprünglich Angst gehabt, dass es eine Art „Wer hat es am weitesten gebracht“-Quiz werden würde. Aber sie hatte sich getäuscht. Niemand aus ihrer alten Stufe war gekommen, um anzugeben. Es war einfach nur nett, und sie quatschte mit ihren alten Freundinnen bei Rotwein und Wasser bis in den frühen Morgen. Es hatte ihr gut getan, alle mal wieder zu sehen. Aber eine Sache war ihr dann doch bemerkenswert erschienen. Niemand aus ihrer alten Freundinnenclique hatte Kinder. Fairerweise musste sie zugeben, dass sie auch keine hatte, und dass sie nicht mit den Mädchen befreundet gewesen war, die eine Heirat mit einem vielversprechenden BWLer inklusive kompletter Finanz-, Karriere- und Familienplanung als Krönung ihres Daseins betrachteten. Ihre Freundinnen waren wie sie, kritisch, ein bisschen versponnen, eher kreativ und ganz und gar unsicher darüber, welche Rolle in der Gesellschaft sie nun eigentlich spielten.
„Ich habe es mir nicht zugetraut“, kam als Argument.
„Ich wollte meinen Kindern nicht das gleiche Schlamassel bereiten, wie meine Kindheit“ oder „wer kann in diese verseuchte, verschuldete und verdreckte Welt denn mit gutem Gewissen Kinder setzen?“
„Aber nun gibt es die Menschheit seit ungefähr 10.000 Jahren und seit eben dieser Zeit bekommen die Menschen ununterbrochen Kinder. 50 Jahre ist es her, und alles wurde anders. Die Menschheit, also die westliche Zivilisation, der ich ja nun mal angehöre, ist aufgeklärt, regelt ihr Leben mit sogenannter Vernunft und hat das Kinderkriegen irgendwie abgeschafft.“ Tara schüttelte stumm den Kopf und ließ ihren Blick über den Horizont schweifen, als schwebten dort hinten an der Bergkette die Antworten auf ihre Fragen.
Das Leben in der Zivilisation einer mitteleuropäischen Großstadt brachte Vorteile mit sich, da war Tara sicher. Sie gehörte nicht zu den Asketen oder Gesundbetern, die alles ablehnten, was neu und vor allem technisch war. Sie war durchaus modern und digital, fand sie jedenfalls. Es gab eine Menge Dinge, auf die sie nicht mehr verzichten wollte. Internet, Handy, Krankenhäuser, elektrische Fensterheber und Spendenbons für die Hamburger Tafel. Auch warmes Wasser zum Duschen, Ökoprodukte, Outlets für Designer- und Sportklamotten gehörten für sie zu den Segnungen eines funktionierenden Lebens dazu. Aber trotzdem hatte ihr die Auseinandersetzung mit Alexander gezeigt, dass es eben doch mehr gab als Versicherungen, Absicherungen und sonstige Sicherungen. Das Leben schien ihr viel zu groß, viel zu vielseitig und zu aufregend, um jetzt schon zu wissen, dass es sich für sie niemals ändern würde. Sie wollte keine absoluten Sicherheiten. Sie wollte nicht heute schon wissen, wo sie in zwanzig Jahren arbeiten, wohnen und einkaufen würde.
Sie wollte das ständig Neue, das Ungewisse und: Ja, sie wollte Kinder! Sie wollte trotz all der Unvorhersehbarkeiten Kinder. Kinder brauchten Liebe und Zuwendung. Sie wusste, sie würde ihre Kinder bedingungslos lieben. Egal wie sie wären. Sie würde keine Erwartungen an sie setzen und sie sich so entwickeln lassen, wie ihre Kinder es bräuchten. Genau das wollte sie: eine Familie, in der sich jeder nach seiner Fasson entwickeln konnte.
Tara gab sich einen Ruck und ließ ihren Blick von der Hügelkette des Horizontes zurück auf die verlassene Tankstelle wandern. Pablo stand noch schwitzend an seiner Zapfsäule und bedeutete ihr mit Gesten, dass er drinnen in dem kleinen Laden einen Kaffee trinken würde. Tara nickte verstehend und verschwand um die Ecke zu den Toiletten. Die Türen waren nicht abgesperrt. Die Einrichtungen präsentierten sich ihr so versifft, als wäre ein Zunami hindurch gefegt. Tara seufzte und dachte etwas belustigt an ihre Meinung über die Segnungen der Zivilisation, die sie ja nun endlich mal hinter sich lassen wollte. Sie zog ihre Hose runter und hockte sich mit den Füssen auf die Klobrille, um zu pinkeln. Der Spülknopf funktionierte zu ihrer Überraschung. Der Versuch, den Wasserhahn in Gang zu setzen, war Fehlanzeige!
„Eine Tankstelle muss irgendeinen funktionierenden Wasserhahn besitzen“, dachte sie und wanderte zurück auf den großen leeren Platz. Die Wasserhähne und der Luftdruckschlauch lagen an der Seite rechts neben dem Gebäude. Tara öffnete den Wasserhahn und ließ sich das immer kälter werdende Wasser über die Hände bis zu den Oberarmen laufen. Sie hielt ihre Pulsadern unter den kalten Strahl, sammelte das Wasser in ihren zum Kelch geformten Händen und schmiss sich die Ladung ins Gesicht. Das Wasser rann ihr über die nackten Schultern und nässte die Haarspitzen. Tara war es gewohnt, sich unter kaltem Wasser zu erfrischen. Nach dem Training oder einem anstrengenden Spiel hielt sie oft den ganzen Kopf unter den Schlauch auf dem Tennisplatz. Nur hier erschien es ihr zu viel des Guten, sie würde anschließend wieder in den zugigen Pick-up steigen. Als sie die Haarspitzen schüttelte wie eine Katze, die in Milch gefallen war, merkte sie, dass sie beobachtet wurde.
Auf der anderen Seite der Tanksäule stand ein Mann. Ein ziemlich großer Mann. Er drückte einen der Zapfhähne in den offenen Tank eines Motorrades und schaute Tara fasziniert bei ihrer Katzenwäsche zu. Ganz offensichtlich tat er das schon länger, dachte Tara, denn er stand dort „wie zur Zapfsäule erstarrt“, lachte sie über ihr Wortspiel. Der Mann war schlank und sah aus wie jemand, der sein Leben lang Sport getrieben hatte. Er hatte einen sehnigen und muskulösen Körper und war von der Sonne gebräunt. Tara schätzte ihn auf Mitte bis Ende dreißig, wobei seine sportlich Kleidung ihn wahrscheinlicher jünger erscheinen ließ, als stünde er im Businesszwirn an der Zapfsäule. Ein Helm hing am Lenker der schweren Maschine und ein Zweiter war hinten am Sitz festgezurrt. Der Mann wandte den Blick von Tara, zog die Benzinpistole aus der Öffnung des Tankes, hängte sie zurück in die Zapfsäule, drehte den Tankdeckel zu und ging mit federnden Schritten zu dem kleinen Kassenhaus. Tara sah ihn durch die verschmutzte Scheibe mit dem Amigo hinter der Kasse reden.
„Offensichtlich spricht der Fremde die Sprache der Einheimischen“, dachte sie amüsiert und ohne den Blick von ihm zu nehmen. Nachdem er bezahlt hatte, kam er zurück und schälte seine Gestalt aus dem Schatten des Hauses. Lässig wanderte er quer über den Platz zurück zu seinem Motorrad. Seine Jeans saßen locker auf den Hüften und ein schwarzes T-Shirt umspannte seinen Oberkörper. An den Füßen sah Tara ein paar Stiefel, wie man sie nur in Spanien kaufen konnte. Seine Haare waren dunkelblond, halblang und wuschelten lockig um seinen, soweit sie das aus der Entfernung beurteilen konnte, gut aussehenden Kopf herum. Tara lehnte sich an die Mauer, die die Tankstellenkasse mit den Toiletten verband und trank aus ihrer Wasserflasche. Der Mann mit dem schwingenden Gang drehte sich um und merkte, dass er von Tara beobachtete wurde.
Ihre Augen begegneten sich irgendwo in der Mitte der Wüstenhitze und für einen Moment spürte Tara einen Stich, der sich vom Hals abwärts bis runter in ihr Herz zog. Es fühlte sich an, als stünde sie mitten in der Wüste in Flammen. Ihre Kopfhaut prickelte. „Was für ein Unsinn“, dachte sie schnell. „So schnell ist das Schicksal nicht, oder?“
Zwei schwarze Krähen zogen am Himmel über sie hinweg und blieben mit lautem Krächzen ein paar Meter neben ihr sitzen, als würden sie ihr die Antwort geben wollen. Tara wendete sich zu den Vögeln. „Okay. Nett gemeint, aber ich bleib mal auf dem Teppich!“ Und doch konnte sie sich das intensive Gefühl nicht erklären: „Es ist, als würde man einen guten Bekannten plötzlich mitten in Hamburg auf der Straße treffen“, dachte sie stolz.
Ja, sie hatte das Gefühl, ihn schon mal gesehen zu haben.
Tara schüttelte verwundert den Kopf. Der Fremde starrte sie immer noch mit leicht zusammengekniffenen Augen an und steuerte auf sein Motorrad zu. Sie musste lachen. „Was für eine Inszenierung! Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich rüberlaufen und ihn um seine Telefonnummer bitten. Aber“, Tara war sich sicher, „sobald ich ihn aus der Nähe betrachte und seine Stimme höre, ist der Zauber dahin. Der Mann entpuppt sich als näselnder Langweiler und die Situation ist einfach nur peinlich.“
„Tara bleib hier stehen!“, befahl sie sich. Sie seufzte ein bisschen und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ein bisschen unheimlich fand sie es schon. „Und jetzt setzt die Musik ein. Das Bladerunner-Thema wäre perfekt“, dachte Tara belustigt.
Lässig nahm er seinen Helm vom Lenker und setzte ihn auf. Tara konnte nun auch erkennen, was für eine Maschine er fuhr. Eine „Vincent Black Shadow“. Eigentlich hatte sie keine Ahnung von Motorrädern, aber genauso eine Maschine fuhr der von ihr verehrte Filmheld und Rennfahrer Steve McQueen. Sie war im Internet beim Surfen auf dieses Motorrad gestoßen. „Werber fahren eine Harley“, hatte Gernot, einer ihrer Freunde und Autoredakteur bei dem Internetmagazin „nova.de“, ihr mal erklärt. „Will er was Besonderes sein, dann fährt er eine Indian. Aber wer es richtig drauf hat, der hat eine Vincent in der Garage.“ So, er hat also eine Vincent. „Na, Ahnung von Motorrädern scheint Wuschelkopf dann ja wohl zu haben“, resümierte Tara.
Der Wuschelkopf ahnte nichts von ihren Gedanken. Immer noch starrte er Tara an, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, an Tankstellen in der Mitte einer spanischen Insel im Atlantik fremde Frauen anzustarren. Was er sah, war eine große, schlanke Frau, die ihm gut gefiel. „Wow!“, dachte er und schüttelte den Kopf. „Wieso sitzt dieses Wesen vom anderen Stern hier in der Wüste und wartet auf diesen miesen Typ im Pick-up?“ Das ging ihn genau genommen nichts an, aber er hatte kein gutes Gefühl bei dem Kerl. Die Frau war süß. Es hatte ihm gefallen, wie sie mit dem Wasser gespielt hatte und sich jetzt selbstvergessen an die Mauer lehnte. Er konnte ihr Gesicht nur aus der Ferne erkennen, aber ihr Typ, ihr Körper, ihre Haltung, ihr ….Alles an ihr gefiel ihm. So etwas war ihm noch nie passiert. Die Frau stand da vor ihm wie eine Erscheinung. Ob er sie ansprechen sollte? Was würde er ihr sagen? „Ich glaube, dein Chauffeur mit dem Pick-up ist ein schmieriger Typ. Steig mal lieber bei mir auf das Motorrad?“ Ganz sicher nicht. Sie würde ihn für komplett bescheuert halten. Sie sah nicht aus, als warte sie drauf, angequatscht zu werden. Andererseits hatte auch sie ihn ins Visier genommen. Er widmete sich seinem Helm, den er am Lenker angeklippt hatte.
„Vamos Señorita.“
Der dicke Pablo riss Tara aus ihren Gedanken und berührte etwas unsanft ihren nackten Ellbogen. Er war, immer noch schwitzend, hinter der Tankstellenbaracke aus Richtung der Toiletten wie aus dem Nichts aufgetaucht, und Tara erschrak leicht.
Si, claro, antwortete sie betont burschikos und schlenderte hinter ihm her in Richtung Pick-up. Als sie den Blick wieder hob, sah sie, wie der Fremde mit seinem Motorrad in einer Staubwolke verschwand. „Schade eigentlich“, dachte sie und kletterte auf den Beifahrersitz. Sie lehnte sich seufzend gegen das Metall, um dem Motorradhelden ein bisschen hinterher zu träumen.
Pablo entfernte sich ein paar Kilometer von der Tankstelle und brabbelte während der Fahrt laut vor sich hin. Tara wollte lieber nicht zu genau wissen, was in seinem Kopf vorging.
Pablos laut ausgesprochene Gedanken waren ihr ein unheimlich. Mit einem Ruck verließ der Wagen die Straße und fuhr einige Hundert Meter querfeldein.
Tara rüttelte an seinem Arm und fragte etwas panisch auf Deutsch, was er vorhabe. Pablo stoppte den Motor und betrachtete sie mit gierigen Augen.
„Ich brauchen Geld. Du mir geben 200 Euros für Fahrt, oder du und ich machen Liebe. Tu muy bonita y yo te quiero!“ Das wenige Spanisch, das Tara verstand, reichte aus, um zu wissen, dass sie sich in einer beschissenen Situation befand.
Scheinbar hielt er eine allein reisende Frau für eine Art Freiwild. Sie musste jetzt ganz vorsichtig sein oder sie würde ganz schnell weglaufen müssen. Das, was hier gerade abging, gehörte nicht zu den Dingen, die man irgendwann seinen Enkeln erzählt. Tara schätzte die Situation ab und bekam Angst. Sie wusste, Angst war genau das, was ihr jetzt nicht weiterhalf. Sie wanderte an einer Kante entlang und diese Kante hieß Gefahr.
Die Tankstelle war zu weit entfernt, um von dort irgendwelche Hilfe zu erwarten. Niemand aus dem Laden würde kommen, um ihr zu helfen. Und was sollte sie auch rufen? „Verdammt, in was für eine beschissene Situation bin ich da geraten?“ Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, keine Angst zu zeigen. Sie würde entschlossen auftreten. Wenn das alles nicht nützte, würde sie Fersengeld geben und zurück zur Tankstelle laufen. Wozu trainierte sie schließlich seit Jahren? Der dicke Pablo konnte sie zwar in seinem Auto verfolgen, aber sie würde es schaffen, da war sie sicher. Pablo starrte so gierig auf ihre nackten Schultern, als seien sie mit Zuckerguss überzogen. Der Schweiß glänzte in seinem Gesicht, und er wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Ihr Herz pochte.
Mit all der Überzeugung, die sie in ihre Stimme legen konnte, rief sie: „No! Tu 50 Euros, nada mas.“ Und: „No Amor!“ Dann sprang sie aus dem Pick-up. Doch Pablo hatte seinen Fahrersitz verlassen und kam auf sie zu. Er redete leise und schleimig auf sie ein, als sei sie ein bockiges Kind. Sie würde Pablo den Spaß versalzen, soviel war klar. So einfach ging das nicht. Auch wenn der schwitzende Mann stärker war als sie, ein paar Muskeln hatte sie auch, und die würde sie einsetzen, bevor sie zurück zur Tankstelle spurten konnte. Sie hatte die Hände in abwehrender Geste vor dem Körper aufgerichtet und wanderte, auf Abstand bedacht, rückwärts.
Das Geräusch von einem ziemlich lauten und hochtourig röhrenden Motorrad unterbrach die absurde Situation. Tara blieb staunend stehen und sah, wie das Motorrad sich unglaublich schnell durch den Wüstensand pflügte und abrupt zwischen ihr und dem schwitzenden Pablo mit einer aufstiebenden Staubwolke zum Stehen kam. Der Fremde von der Tankstelle stieg ab und marschierte, noch während er seinen Helm vom Kopf nahm ziemlich wütend auf Pablo zu. Pablo machte auf dem Absatz kehrt und verschwand behände wie ein Äffchen in der Führerkabine des Pick-ups. Noch bevor sich der Mann zu Tara umwenden konnte, sauste der Pick-up in einer Staubwolke davon.
„Und mein Koffer samt Handtasche mit ihm!“, dachte Tara und schaute dem Auto entgeistert hinterher.
Taras Beine begannen zu zittern. Sie ging langsam ein paar Runden im Kreis, atmete dabei ein paar Mal tief aus und erhob ihren Blick in die immer noch wütenden Augen des Mannes.
„Danke! Das war dann wohl Rettung in letzter Minute!“ Als der Fremde merkte, dass es Tara wieder besser ging, verschwand die Wut und ein Lächeln breitete sich über sein Gesicht. Eine gebräunte Hand streckte sich ihr entgegen.
„Ich heiße Luke.“
Tara schaute trotz des Schrecks halb belustigt, halb verärgert in Lukes Augen. „Tara mein Name. Ich habe heute Morgen meinen Heimatkral in Hamburg fluchtartig verlassen, bin gerade auf der Insel angekommen und dann so was!“ Sie schüttelte den Kopf. „Was für eine Wanze! Was wollte der Kerl denn von mir?“
„Du wirst ihm gefallen haben.“
„Na, so ein Schlaganfall bin ich nun nicht, dass man gleich über mich herfallen muss!“
„Das kommt auf den Betrachter an.“
Luke lächelte und schob sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Tara blickt ihm direkt in die Augen und sah, dass Luke ihrem fragenden Blick standhielt.
„Das ist ja eine tolle Insel! Erst gibt es keine Leihwagen mehr, Taxis ebenso wenig. Dann frage ich dumme Kuh diesen schleimigen Wurm, ob er mich für 50 Euro in den Norden fährt. Dann kriegt er unterwegs einen Hitzschlag mit Hormonkoller. Und will seine Bezahlung fürs Mitnehmen in Naturalien. Und jetzt erzählt mir mein fremder Retter, dass ich gut aussehe. Und was das Beste ist! Mein Koffer und meine Tasche, also alles was ich habe, liegt auf der Ladefläche des Pick-up und fährt mit ‚Wanze’ auf und davon.“
Tara atmete tief aus nach dieser Entladung, und Luke lachte unauffällig in sich hinein.
„Tja“, meinte er amüsiert von dem Temperamentsausbruch, „vielleicht hast du ein unentdecktes Talent und diese Insel bringt es zum Erblühen.“ „Und was soll das sein?“, fragte Tara neugierig. „Na, nach dem ersten Eindruck würde ich es mal ‚Talent für Schlamassel’ nennen. Ich werde dich jedenfalls nicht alleine hier stehen lassen. Irgendwie hast du dein neues Talent noch nicht so ganz im Griff.“ Tara boxte ihn scherzhaft in die Rippen und zog ein Gesicht, als sei sie gerade vom Lehrer beim Abschreiben erwischt worden.
Luke löste den zweiten Helm vom Sitz und drückte ihn Tara mit einem Grinsen in die Hand. „Dann wollen wir der stinkenden Wanze deine Sachen mal wieder abzujagen.“
Tara setzte den Helm auf, machte den Riemen enger, schwang sich auf den Rücksitz und legte ihre Arme um den Rücken ihres Retters. „Mmh“, murmelte sie zustimmend, lehnte sich gegen seinen Rücken und dachte: „Doch kein näselnder Langweiler. Dieser Rücken fühlt sich ziemlich gut an.“
Zubehör
| Produkt | Hinweis | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
|
11,98 € * | |||
|
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
Details zum Zubehör anzeigen
|
||||
Diese Kategorie durchsuchen: Romane & Erzählungen

1 Die Ankunft
Als das Flugzeug aufsetzt, spürt sie den Stoß, spürt auch, dass es sich noch einmal ein wenig hebt, ganz kurz nur, um dann endgültig zu landen.
‚Endlich’, denkt sie.
Stunden zuvor hatte sie aus dem Fenster gesehen. Der Flug war unruhig geworden, und tief unten erkannte sie eine Küste, es war Labrador. Sie saß hinter der rechten Tragfläche und sah, wie sie vibrierte. Nach einer Weile war alles wieder ruhig, und sie waren lange über eine weite, graugrüne Landschaft geflogen, in der sie nur allmählich Seen und Wasserläufe ausmachen konnte, aber sie sah kein Zeichen menschlicher Besiedlung.
Dann tauchte hier und da der hellere Strich einer Straße auf, und nach und nach verbanden sich die Striche wie zu einem Netz. Später waren Wälder zu erkennen, und Seen glänzten herauf. Manchmal sah sie den Sankt-Lorenz-Strom, wie er sich breit durch das Bild wand. Nur langsam wurde er schmaler.
An seinem Ufer suchte sie Städte, die sie aus dem Atlas kannte: Baie Comeau lag am nördlichen Ufer, da, wo ihr Fenster war; auch Trois Pistoles lag dort. Bedeutete der Name vielleicht, dass Menschen sich in dieser Einöde bekriegt hatten, womöglich bis aufs Blut? Und warum? Rivière-du-Loup lag am Südufer des Stroms, sie konnte es nicht sehen. Hatten die französischen Siedler an diesem Fluss Wölfe gesehen oder sich sogar davor gefürchtet? Namen hatten sie schon immer fasziniert. Deshalb wusste sie auch, dass die Mikmaq-Indianer in Rimouski Elchen begegnet waren, vielen Elchen. Hier fühlte sie sich wohler als bei den Erinnerungen an Hass und Angst, welche die früheren Ortsnamen ihr suggeriert hatten. Von Nordwesten her mündete ein breiter Fluss in den Sankt Lorenz, der Saguenay.
Zwischen Québec City und Trois-Rivières sah sie jetzt öfter Straßen, erkannte auch kleinere Orte. Doch bevor sie nach Montréal kamen, hatte der Pilot den Sankt-Lorenz-Strom verlassen und Kurs auf Ottawa genommen. Als sie darüber hinweggeflogen waren, hatte er sich noch einmal gemeldet und seine Passagiere auf the nation's capital aufmerksam gemacht. Mit Mühe konnte sie die Parlamentsgebäude sehen, die in einer Flussbiegung standen. Aber dann glaubte sie sogar, geflößte Baumstämme zu erkennen, die den Fluss vom Ufer bis zur Mitte bedeckten.
Sie verließen ihre Flughöhe, und allmählich begann der Landeanflug auf Toronto. An den Straßen standen vereinzelt Farmen, und dann leuchtete von Westen her ein großer See herauf: Lake Simcoe. Als das Flugzeug eine steile Kurve zog, kam es ihr vor, als stehe das Wasser senkrecht vor ihrem Fenster. Sie dachte über den Namen nach und glaubte, dass der See nach einem der früheren Lieutenant-Governors von Ontario benannt war. Dann richtete sich das Flugzeug wieder auf, und bald darauf sah sie, wie sich Toronto in das Land hineinfraß. Die vielen Siedlungen ähnelten einander mit ihren kurvigen Straßen und ihren Sackgassen, die den Bewohnern ein heimeliges Gefühl geben sollten. Dennoch wirkte alles wie am Reißbrett entworfen. Indem sie die Landemanöver verfolgte, tauchte an den Köpfen der Mitreisenden vorbei durch das linke Fenster das Stadtinnere auf mit dem Fernsehturm und den Hochhäusern um ihn herum. Aus der Entfernung wirkte er wie eine Glucke mit ihren Kücken, nur dass es mechanischer aussah. Über allem lag eine gelblich-graue Schicht: die Luftverschmutzung. Hinter der Stadt leuchtete der Ontariosee.
Lange fuhren sie über das Rollfeld. Alles kam ihr weit und leer vor. Die langen, hellen Korridore im Terminal, die Laufbänder, das war wie überall. Als sie in einer der vielen Schlangen stand, die sich vor den Einreiseschaltern gebildet hatten, sah sie die Passbeamten, die mit ihren schusssicheren Westen und den Pistolen am Gurt an Pulten saßen und Computer-Terminals vor sich hatten. Über jedem war ein Metallraster, in dem das Bild einer flatternden rot-weißen Ahornfahne leuchtete. Anna mochte die Fahne, denn sie kam ihr friedfertig vor. Welche Nation hatte schon ein Blatt als nationales Symbol? Es schien ihr aber, dass die vielen Fahnen aussehen sollten als ob sie im Wind flatterten, wo sie sich doch nur in dem Gleichmaß bewegten, das der Takt der schnell wechselnden Stromstöße vorgab.
‚Schade’, dachte sie, indem sie das mit dem Anflug eines Lächelns betrachtete. Sympathisch fand sie dagegen das Völkergemisch um sich herum. Die Leute redeten in den unterschiedlichsten Sprachen und hielten Pässe in vielen Farben in den Händen. Ihren Rucksack, den sie zwischen den Beinen abgestellt hatte, schob Anna langsam weiter nach vorn.
Als sie an der Reihe war, fragte der Beamte, ein junger Mann, der aussah, als ob er aus der Karibik war, wie lange sie in Kanada bleiben wolle, und als sie antwortete, bis zu einem Jahr, fragte er, wie sie sich denn die viele Zeit vertreiben wolle.
„Material für meine Doktorarbeit sammelnˮ, sagte sie.
Da wollte er wissen, ob sie dafür von einer kanadischen Stelle Geld bekomme. Sie verneinte, und er schien beruhigt. Aber dann fragte er doch noch, was für eine Doktorarbeit das werden soll. Darauf ließ sich nicht so kurz antworten, wie er es sich in seiner Naivität vielleicht dachte. Es sei eine Arbeit über die Soldaten, die der englische König gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts bei den deutschen Landesfürsten gemietet hatte, damit sie gegen die amerikanischen Aufständischen kämpften, sagte sie, genauer über diejenigen von ihnen, die dann in Kanada geblieben und hier sesshaft geworden seien. Als er sie nachsichtig anlächelte, glaubte sie schon, er wolle sie fragen, wen denn so alte Geschichten noch interessieren. Dann hätte er einiges zu hören gekriegt, denn dass deutsche Fürsten ihre Landeskinder verschacherten, machte sie immer noch wütend. Er wünschte ihr aber nur good luck und wandte sich den nächsten Passagieren zu.
2 Little Italy
Anna nahm nach langem Warten ihren Koffer vom Band und gab den Zettel, den sie im Flugzeug ausgefüllt und auf den der junge Mann noch irgendein Zeichen gemalt hatte, einem Zöllner, der am Ausgang aus dem Gepäckraum auf einem hohen Hocker thronte. Als sie durch die automatische Schiebetür ging, standen viele Leute in der Halle, die jemanden abholen wollten. Manche hielten Namensschilder hoch. Anna wurde nicht erwartet.
Am Ausgang nahm sie ein Taxi. Sie wollte nach Little Italy, in den Stadtteil, wo die meisten Einwanderer wohnten. Die Frage des Fahrers nach der Adresse konnte sie kaum verstehen; offenbar stammte er nicht aus Kanada. Sie überlegte noch, woher der Mann sein könne, als er seinerseits fragte, woher sie denn käme.
„From Germanyˮ, antwortete sie.
Das reichte ihm als Freibrief zum Erzählen. Er stamme aus der Türkei, aus der Nähe von Izmir, sagte er. Nein, den Kanadiern sei es egal, wer ihnen die Arbeit macht; diskriminiert habe er sich nie gefühlt. Alle seine Kinder hätten ein College besucht, eines sogar die Universität. Die Jüngste sei noch in der Ausbildung. Alle Tore stünden ihnen offen, anders als ihm. Der Einwanderergeneration bleibe nur die einfache Arbeit; das sei überall so. Na ja, gemacht werden müsse die schließlich auch, und die Kinder könnten dann auf den Schultern der Eltern stehen. Er sagte das mit sichtbarem Stolz.
„Sind Sie zum ersten Mal in Toronto?ˮ, wollte er wissen, als er von der vielspurigen Autobahn ab- und in eine Straße einbog, die geradeaus nach Süden lief.
Sie bejahte und erzählte ihm, dass sie einige Zeit bleiben würde. Rechts und links waren Geschäfte, es gab auch Bäume; sie kamen an einem Busbahnhof und bald darauf an einem riesigen Friedhof vorbei. Oft mussten sie warten, weil die Ampeln rot waren.
‚Es sieht aus wie überall’, dachte sie etwas enttäuscht. Einmal merkte sie, dass der Fahrer sie im Rückspiegel beobachtete, wie sie sich alles ansah.
„Das ist die Yonge Streetˮ, sagte er, „es soll die längste Straße der Welt sein. Warum die Leute das glauben, weiß ich nicht; wahrscheinlich, weil auch in Kanada alles größer, schneller und schöner sein muss als anderswo. Die meisten Kanadier sind eben noch nicht in der Gegend von Izmir gewesen.ˮ Seine Augen und Zähne blitzten in einem gutmütigen Lachen.
Die Yonge Street beginne am Ontariosee und ende hoch oben in der kanadischen Arktis, wahrscheinlich in einem Iglu. Anna war unsicher, ob sie das glauben sollte oder ob er es sich gerade ausgedacht hatte. Einmal sei der damalige Premierminister Trudeau hingeflogen, aber die Eskimos hätten nur ihr Inuktitut gesprochen, nichts verstanden und gar nicht gewusst, welch hohen Besuch sie bei sich hatten. Das sei ihnen auch gleichgültig gewesen, denn gastfreundlich waren sie sowieso.
Die Yonge Street teile Toronto in eine östliche und eine westliche Hälfte, sagte er, sie werde ja sehen. Dann ging es um einige Ecken. Die Straßen waren noch immer gerade, fast wie mit dem Lineal gezogen, allmählich wurden sie aber schmaler, und die Häuser wurden niedriger; es waren Wohnhäuser.
Die kleine Wohnung, die Anna schon von Hannover aus gemietet hatte, lag im oberen Stockwerk in einem der vielen engen Häuser, die schon aus dem neunzehnten Jahrhundert stammten.
Die Wirtin begrüßte sie; ihre beiden Mädchen versteckten sich hinter ihrer Mutter und sahen neugierig auf die Fremde, die nun bei ihnen wohnen würde. Anna schleppte ihren Koffer die enge Treppe hinauf.
Oben packte sie aus. Zuerst die Manuskripte. Sie traute ihrem Laptop nicht ganz; man brauchte nur eine falsche Taste zu drücken, oder ein Virus schlich sich über das Internet ein, und schon war alles hin. Deshalb hatte sie das Wichtige schon zu Haus ausgedruckt, auch die Bibliographie und die Liste mit den Archiven und Bibliotheken, in denen sie Dokumente für ihre Arbeit zu finden hoffte. Die legte sie, zusammen mit dem Futteral, in dem sie ihre Flöte hatte, vorsichtig in ein Schrankfach im Wohnzimmer.
Das kleine Badezimmer enthielt nur eine Dusche und ein Waschbecken. Hierher brachte sie, was sie für ihre Hygiene brauchte. Im Schlafzimmer war noch ein Schrank. Mit ihrer Kleidung war Anna großzügiger und warf die meisten Sachen, wie sie aus dem Koffer kamen, einfach in die Fächer. Zum Glück gab es aber auch ein paar Bügel. Die kleinen Dornen in den Hosenaufhängern waren praktisch, denn nun konnten die Hosen nicht herausrutschen und zur Erde fallen. Sie fand sie aber auch enttäuschend, nicht weil die kleinen Druckstellen unten in den Hosenbeinen manchmal sichtbar blieben wie winzige Löcher, sondern weil sie diese Bügel aus Deutschland kannte. Da reist man nun über Land und Meer, und dann findet man immer noch die gleichen chinesischen Plastikbügel. Als alles an seinem Platz war, hatte sie Hunger. Sie ging in das kleine Einkaufszentrum in der Nähe, von dem ihre Wirtin gesprochen hatte. Mit den Kanadiern würde sie schon zurechtkommen; sie war ja nicht zum ersten Mal im Land.
Anna war ein Einzelkind, und damals zum Abitur hatten ihre Eltern ihr eine Reise nach Nordamerika geschenkt. Vater und Mutter waren aber mitgefahren. Seitdem hatte sie davon geträumt, noch einmal allein herzukommen, und nachdem sie sich bei ihrem Studium der Amerikanistik in Göttingen lange genug mit dem Land beschäftigt hatte, dachte sie, die Zeit sei nun gekommen. Diesmal kam sie mit einer festen Absicht: Sie wollte ergründen, wie aus deutschen Rekruten kanadische Bauern geworden waren, deren Kinder, vor allem dann die Enkel, sich hier so sehr zu Haus fühlten, dass sie Deutschland als ein seltsames, fernes Land ansahen. Sie hatte gelesen, dass sie schon die deutsche Sprache, die ihre Eltern ihnen beigebracht hatten, nicht mochten und dass auch der Akzent, der sich niemals aus dem Englisch ihrer Eltern oder Großeltern verlor, ihnen peinlich war.
Anna fand das Einkaufszentrum, fand auch ein Selbstbedienungsrestaurant, und nachdem sie sich Reis, Salat und Hühnerfleisch, dazu eine Banane und eine Tüte Milch auf ihr Tablett gelegt hatte, setzte sie sich an einen freien Tisch. Es schmeckte wie in Deutschland, denn wie die Kleiderbügel war auch das Restaurant chinesisch. Zwar war es nicht so blitzblank, nicht ganz so gepflegt wie zu Haus, aber das fand sie gut, denn dadurch wirkte alles etwas gelassener. Später sah sie sich die Reihe der kleinen Läden an und kaufte noch ein paar Lebensmittel. Dann war sie müde. In Hannover war Mitternacht längst vorbei.
Am andern Morgen war sie schon kurz nach vier wieder wach: Zu Haus waren sie schon lange auf den Beinen; so gesehen hatte sie länger geschlafen als sonst. Der Tag gestern war aber auch lang gewesen: Erst der Abschied von den Eltern, die sie nach Langenhagen zum Flughafen gebracht und nicht aufgehört hatten, ihr Ratschläge zu geben, bis sie durch die Kontrolle gegangen war, und dann kam das Umsteigen in Amsterdam, wo Air Canada sie von ihrem reservierten Platz vertrieben hatte, weil irgendeine Hockeymannschaft zusammensitzen wollte. Dann der lange Flug und schließlich die Fahrt in die Stadt.
Sie blieb noch eine Weile liegen, sah sich im Zimmer um und fühlte sich einsam. Sie war schon oft in fremden Ländern aufgewacht: In Europa war sie erst mit den Eltern und dann als Studentin mit Freunden herumgereist. Sie war auch in Südafrika und in der Türkei gewesen, wenn auch nicht gerade in Izmir. In Nordamerika waren ihre Eltern mit ihr über New York und Washington nach Los Angeles geflogen, und dann hatten sie sich einen Wohnwagen gemietet und waren damit die Westküste hinaufgefahren, bis nach British Columbia. Sie erinnerte sich noch gut an die hohen Berge und die Wälder mit den großen Redwood-Bäumen. Links von ihnen war immer die Küste gewesen, und jeden Abend waren sie auf einen anderen Zeltplatz gefahren. Die Größe der Plätze, die ihnen zugewiesen wurden, und die weiten Abstände zu den Nachbarn hatten sie beeindruckt. Keinen campfire talk der Rangers, bei denen es meistens um Entwicklungen in der Natur ging, die in Jahrmillionen stattgefunden hatten, ließ sie aus. Es war, als hätte sie Platz zum Atmen gekriegt – räumlich und zeitlich. An die Niagarafälle kamen sie bei dieser Reise nicht; Vater hatte gemeint, man werde das nachholen.
Bloß das nicht! Zum ersten Mal war sie allein unterwegs. Zwar kam sie sich einsam und verloren vor, aber sie fühlte sich frei. Draußen klatschten hin und wieder Autoreifen auf den Asphalt, und es war auch zu hören, wie jemand im Haus in einer ihr fremden Sprache redete. Hier ging alles seinen Gang, von dem sie erst noch ausgeschlossen war. Diesmal würde sie jedenfalls nicht durch die Weltgeschichte bummeln, um dies und jenes zu bestaunen, sie würde auch nicht mit Kumpanen am nächtlichen Lagerfeuer hocken, sondern sich so auf ihre Arbeit konzentrieren, dass sie ihr Fremdsein vergessen würde. Sie wollte auch beruflich vorwärtskommen, aber davon hatte sie noch keine genauen Vorstellungen.
Jedenfalls wollte sie nicht zurück. Es wäre auch nicht gegangen. Ihre Eltern hatten eine Art Museum aus ihrem Zimmer in Hannover gemacht, in dem die Plüschtiere, die Poster und die Ikea-Möbel an ihrem Platz blieben. Es war schon lange nicht mehr ihr Zimmer; allmählich war es ihr fremd geworden. Auch ihre Studentenbude in Göttingen hatte sie aufgegeben, zugleich mit dem Leben zwischen Seminarräumen, Bibliotheken und Discos. Eigentlich war sie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst verpflichtet, ohne den sie nicht hergekommen wäre. Ihr Vorhaben musste das Auswahlkomitee hinreichend beeindruckt haben, denn es hatte ihrem Antrag auf ein Jahresstipendium zugestimmt, was sie etwas gewundert hatte. Sie würde zwar nach ihrer Rückkehr Rechenschaft geben müssen, aber das war noch ein ganzes Jahr hin.
Mark, ihr Freund in Göttingen, hatte Betriebswirtschaft studiert und vor einem Monat seine erste – vorläufig noch befristete – Stelle gefunden. Als sie ihm nach ihrer Magisterprüfung vor anderthalb Jahren gesagt hatte, dass sie promovieren und erst noch ein Jahr nach Kanada gehen wolle, war er zuerst traurig, dann aufsässig geworden, denn er hatte sich ein geregeltes Eheleben in Niedersachsen ausgemalt. Aber ihre Abneigung gegen ein Dasein, das sich am Gängigen orientierte, war gewachsen, als sie daran dachte, dass sie schon als Referendarin jeden Morgen in die Schule gehen und auf dem Nachhauseweg vielleicht noch einkaufen und das Kind, das Mark sich wünschte, aus der Krippe abholen müsse. Sie war neugierig. Sie wollte hinaus, wollte die Welt kennenlernen, zuerst Kanada. Davon hatte sie Mark lange nichts gesagt; wahrscheinlich hätte er sie doch nicht verstanden. Nun wollte er ihrer Hybris, wie er es nannte, nicht nachgeben, und so war es eben zum Bruch gekommen.
Sie sah an die Decke und wusste noch immer nicht, ob sie in dieser fremden Stadt vor allem frei oder eher einsam sein würde. Dann dachte sie, dass beides zugleich möglich sein müsse, und als sie zu der Ansicht kam, dass diese Frage nun sowieso müßig sei, stand sie auf. Sie glaubte, dass das vor ihr liegende Jahr wie ein weit offenes Land sei, in dem sie ihren Weg suchen wollte. In Deutschland wäre er eher vorgezeichnet gewesen.
Sie schob den dunkelbraunen Fenstervorhang zurück. Im schwachen Dämmerschein erkannte sie die gerade Straße, die Häuser, die mit ihren Vorgärten dicht nebeneinander standen; schräg gegenüber stand eine Tanne, die höher war als das Haus dahinter. Sie versuchte eine Weile, das Alter der zwei- und dreistöckigen Häuser zu schätzen, deren Giebel meist der Straße zugewandt waren, und die kleine, oft verwilderte Vorgärten hatten, und war froh, als das Scheinwerferlicht eines vorbeifahrenden Autos die Fassaden matt erleuchtete und ihr dieses Vorhaben etwas erleichterte.
Die meisten Häuser stammten wirklich aus dem neunzehnten Jahrhundert; sie waren viktorianisch. Hölzerne Treppen führten auf überdachte Vorbauten mit tiefblau, grasgrün oder rostrot bemalten Säulen. Hüfthohe Balustraden, die von einer Säule zur nächsten reichten, ließen die Vorbauten aussehen wie Veranden. In der Morgendämmerung erkannte sie, dass die Eingangstüren von hier aus in die Häuser führten. Am Himmel stand noch immer ein Stern.
Als die Straße allmählich von einem fahlen Morgenlicht erleuchtet und die Spitze des Giebels drüben auf der anderen Seite in das erste Sonnenlicht getaucht wurde, erkannte sie die beiden aus breiten Brettern gezimmerten und mit bequemen Lehnen versehenen Sessel auf der Veranda gegenüber. Sie sah auch, dass die Giebelfassade des Hauses drüben sich aus zwei Teilen zusammensetzte, die farblich voneinander unterschieden waren. Die rechte Hälfte bestand aus unbemalten roten Ziegelsteinen, die linke war mit hellgrauer Farbe übertüncht. Eine gerade Trennungslinie lief vom Höhepunkt des Giebeldreiecks abwärts. Es war ein Zweifamilienhaus. Der linke Nachbar hatte auch den niedrigen Zaun, der seinen Vorgarten vom Gehsteig trennte, mit leuchtender, hellgrauer Farbe gestrichen, und der Garten selbst war längst nicht so verwildert wie der rechts davon mit seinen zum Teil schon vertrockneten Büschen.
Ob sich darin wohl nationale Unterschiede äußerten, ob der linke Nachbar vielleicht ein Skandinavier und der rechte ein Italiener war? Anna trat vom Fenster zurück. Aus ihren gestrigen Einkäufen machte sie sich ein Frühstück. Eine Kaffeemaschine war da, auch ein Fernseher, aber den schaltete sie nicht ein. Sie wollte schnell aus dem Haus; sie wollte wissen, wo sie war. Um halb sieben ging sie die Straße entlang. An der rechten Straßenseite waren in einer ununterbrochenen Reihe mittelgroße und kleinere Autos geparkt. Sie bog links ab und kam in eine Straße, die der ihren glich: Auch hier waren die Häuser meistens zwei- oder dreistöckig, immer waren diese Vorbauten davor, auf die ein paar hölzerne Stufen hinaufführten, und alle standen sie in einer langen Reihe hinter ihren jeweiligen Vorgärten. Oft waren die Außenwände in einem freundlichen Blau gestrichen, während die zahlreichen viktorianischen Ornamentierungen weiß leuchteten. Manchmal war das obere Stockwerk nachträglich mit einem Erker oder einem Balkon in imprägniertem Naturholz versehen. Einmal entdeckte sie in einem der oberen Erkerfenster, das schon von den ersten Sonnenstrahlen beschienen wurde, farbiges Glas. Das leuchtete rot und grün.
Immer hatte sie geglaubt, dass in Nordamerika alles größer sei als in Europa. Aber die Straßen, die Häuser und die Autos hier in Little Italy waren unscheinbar und klein. Dafür gab es die Sterilität, die sie an Hannover und Göttingen oft beklagt hatte, kaum. Als sie sich in Deutschland informiert und Little Italy auf einem Stadtplan von Toronto entdeckt hatte, hatte sie gleich hier wohnen wollen, nicht nur wegen der niedrigen Mietpreise, sondern weil sie sich von dem Namen etwas Pittoreskes versprochen hatte, das sie nun in der Wirklichkeit wiederfand. Daran konnte sie sich erstmal halten.
Sie kam auf eine größere Straße, wo schon mehr Verkehr war. Kleine Läden waren aneinandergereiht. Wenn hier geöffnet war, konnte man elektrische Apparate kaufen, sich die Haare schneiden lassen, Hochzeitskleidung mieten, man konnte mexikanisch, griechisch oder italienisch essen oder Kinderspielzeug kaufen. Sie sah sich die Schaufenster an und entnahm den Öffnungszeiten, dass man es hier etwas langsamer angehen ließ als in Hannover. Alles sah aus, als ob die Leute sich an einen Rest Menschlichkeit klammerten, den sie nicht aufgeben wollten.
Nachdem sie eine breite Allee überquert hatte, kam sie ins Universitätsviertel. Sie ging hindurch. Links ragte einmal aus grünen Rasenflächen ein hohes, hellgraues Gebäude mit schmalen Fenstern auf. Es sah aus wie eine moderne Festung. Sie erkannte es, denn sie hatte es im Internet gesehen: die Bibliothek. Dort würde sie arbeiten. Dann kam rechts eine weite Rasenfläche, an deren hinterem Ende zwischen langgestreckten Gebäuden ein Turm stand, dessen Zinnen wie Krallen in den Himmel ragten, und links befand sich die historisierende Fassade eines College, dem eine Kapelle mit großen, neugotischen Fenstern angegliedert war.
Anna ging weiter. Blumen blühten üppig, Backstein wechselte mit Kalkstein, Neorenaissance mit Neugotischem, bis sie an den Queen's Park kam, einen ausgedehnten Park mit alten Bäumen. Nach Süden hin wurde er durch das Parlament von Ontario begrenzt. Lange saß sie auf einer Bank, dicht bei der kolossalen Reiterstatue irgendeines englischen Königs und musste lachen, weil jemand dem bronzenen, gleichmäßig patinierten Pferd den Hodensack rosa bepinselt hatte.
Als sie auf der anderen Seite aus dem Park trat, waren die Universitätsgebäude noch immer nicht zu Ende: Colleges, Wohnheime und kleinere Bibliotheken waren dort, und dann ging sie zwischen zwanzig- und dreißigstöckigen Wohnhäusern hin, von denen manche noch im Bau waren. Inzwischen waren viele Menschen unterwegs, die Sonne hatte Kraft bekommen, der Berufsverkehr zugenommen, die Autos schoben sich langsamer voran. Sie kam wieder an die Yonge Street. Weil sie wissen wollte, wie der Straßenname, den sie auf einem Schild las, wirklich ausgesprochen wurde – sie wollte sich nicht auf den türkischen Taxifahrer verlassen –, fragte sie zwei Mädchen. Die kicherten, aber dann sagten sie es ihr. Es klang wie das englische Wort für jung. Als sie auf der Straße in südlicher Richtung hinunterging, erkannte sie an ihrem Ende eine Stadtautobahn; dahinter vermutete sie den Ontariosee.
Wieder reihten sich Geschäfte aneinander. Sie ging an Boutiquen, Restaurants, Nachtclubs und Pfandleihen vorbei; manchmal waren die Häuser klein und halb verfallen und die Auslagen verstaubt. Dann wieder neue, große Gebäude.
Am Mittag kam sie müde vom Laufen in ihre Wohnung zurück. Unterwegs ging sie noch in einen Corner Store, in dem es Getränke, Blumen und Zeitungen gab. Als sie die Stufen zu ihrer Veranda hinaufstieg, saß dort in einem hölzernen Lehnstuhl, der dem von gegenüber glich, nur dass er mit bequemen Kissen versehen war, ein alter Mann, den Krückstock zwischen den Knien, die wachen Augen auf sie gerichtet. Sie sei wohl die neue Mieterin from the old country.
„Ja, aus Deutschland.ˮ
Das kenne er etwas. Früher habe er mal ein paar Jahre in Bremen gearbeitet, im Straßenbau. Das sei aber schon so lange her, dass damals noch gar nicht an sie zu denken gewesen sei. Überall in der Stadt habe es noch Ruinen gegeben, aber jetzt sei wahrscheinlich alles ganz neu. Was sie denn hier in Kanada wolle.
„Material für meine Doktorarbeit sammeln, Dokumente, die noch viel älter sind als Sie.ˮ Er freute sich über ihre Schlagfertigkeit.
„Sowas soll es geben? Und ausgerechnet hier?ˮ
„Bestimmt. Hier hat es Deutsche gegeben, die schon lange vor Ihnen angekommen sind.ˮ
„Möglich ist das, Deutsche trifft man ja überall. Aber seit es ihnen zu Haus so gut geht, kommen bloß noch Touristen. Die Italiener oder Griechen sind da zuverlässiger. Es ist wie immer: Erst kommen die einen, die sich durchschlagen müssen, und später die andern, die es leichter haben und sich für die Arbeit ihrer Väter nur interessieren, wenn sie was Kluges darüber sagen oder schreiben wollen. Nimm mir das man nicht übel; das ist bei den Portugiesen und Italienern nicht anders als bei den Deutschen.ˮ Er sprach in einem holprigen Englisch; der iberische Akzent war deutlich.
„Sind Sie denn Portugiese? Ich habe gedacht, dieser Stadtteil heißt Little Italy.ˮ
„Heißt er auch. Meine Tochter hat einen Italiener geheiratet, der arbeitet auf dem Bau, wie ich früher. Jetzt kann sie außer Portugiesisch und Englisch noch fließend Italienisch. Bloß ich bin immer noch Portugiese.ˮ
„Dann habe ich ja mein bisschen Ferien-Italienisch umsonst aufpoliert.ˮ
„Na, wenn du mit mir sprechen willst, hilft es nicht viel; wir müssen wohl oder übel versuchen, uns auf Englisch zu verständigen. Das wird schon gehen. Aber mein Schwiegersohn freut sich bestimmt über ein paar Worte Italienisch, meine Tochter auch. Auf Wiedersehenˮ, rief er ihr noch auf Deutsch nach, als sie ins Haus ging.
Zubehör
| Produkt | Hinweis | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
|
14,98 € * | |||
|
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
Details zum Zubehör anzeigen
|
||||
Auch diese Kategorien durchsuchen: Für die Schule, Geschichte, Politik, Wirtschaft & Gesellschaft, Romane & Erzählungen, Wissen, Natur & Technik, Startseite - Verlag



 Kagel: Geschenksendung, keine Handelsware - Chronik einer langen Flucht
Kagel: Geschenksendung, keine Handelsware - Chronik einer langen Flucht


 Riesenslalom
Riesenslalom

 Lehnen: wiederkehren
Lehnen: wiederkehren